
Lesedauer: ca. 6 Min.
Autor: Stephan Baier I Illustration: Carina Crenshaw
Alles andere als perfekt.
Makellos, tadellos, rundum brilliant. So stellen wir uns Helden und Heilige vor, nicht wahr? Stimmt aber nicht: Helden, Genies, Vorbilder, ja sogar die Heiligen der Kirche sind Menschen wie Du und ich – mit Stärken und Schwächen, mit Talenten und Macken. Das beginnt schon mit den Typen, die Gott selbst ruft und sendet.
Hier ein paar prominente Beispiele aus der Bibel.

David
Ein erfolgsverwöhnter Womanizer
David ist der Superstar seiner Zeit: schön, intelligent, mutig, stark, sympathisch, großzügig, bewundert und beliebt, von gewinnendem Wesen, riesig erfolgreich und sehr musikalisch. Ein Mega-Influencer, den jeder von uns wählen würde. Seine Zeitgenossen waren sich einig:
So geht König!
Ausgerechnet von diesem Superhelden, dem „Marvel“ eine Serie widmen sollte, zeigt uns die Bibel den ultimativen Fehltritt: David ist bereits ein erfolgreicher Womanizer und kann sich über einen Mangel an Groupies nicht beklagen. Da erblickt er vom Flachdach seines Palastes aus eine Frau beim Baden, und die war, wie wir uns denken können, „sehr schön anzusehen“. Nur leider verheiratet. Das heißt für fromme Könige: Finger weg! Doch David schläft mit ihr. Der Seitensprung bleibt nicht ohne Folgen und jetzt verstrickt sich David immer mehr im Chaos seiner Sünden: Erst versucht er den Gatten der Holden, den Krieger Urija, abzufüllen, damit der mit seiner Frau schläft und das Kind für sein eigenes hält. Als das misslingt, lässt er Urija in die erste Schlachtreihe stellen, damit er im Kampf umkommt.
„Dem Herrn aber missfiel, was David getan hatte“, sagt die Bibel trocken. Gott sendet den Propheten Natan zu dem königlichen Womanizer – und der wäscht David gehörig den Kopf. Ein anderer hätte Natan wohl einen Kopf kürzer gemacht, doch David verteidigt sich und seine Taten keine Sekunde. Sondern er bereut sein Fehlverhalten – und erfährt Vergebung. Gott straft ihn, Gott beschenkt ihn. Vertuscht wird hier aber gar nichts.

Moses
Der sprachbehinderte Heißläufer
Ein Kraftlackel, mit großen Händen und Muskeln wie ein Bodybuilder. Moses ist ein Macher, ein Mann der Tat, ein Alphatier. Doch als Gott ihn verwenden will, ist Moses ganz auf seine Schwächen fokussiert (wenn auch auf die harmloseren, wie wir gleich sehen werden). Er redet schwer („Mein Mund und meine Zunge sind schwerfällig“) und fürchtet, dass die Leute ihm nicht glauben. „Bitte, Herr, schick’ doch einen anderen!“, fleht er. Kennen wir das irgendwie?
Gott lässt nicht locker, bis sich Moses vorbehaltlos in seinen Dienst stellt. Furchtlos tritt er dem Pharao entgegen, der auch kein Weichei gewesen sein dürfte. Konsequent befolgt er Gottes Weisung. Seine Schwächen (die weniger bewussten) verschwinden nicht: So tapfer und heroisch der Mann ist, er kann richtig jähzornig werden. Die erste Tat, die die Bibel von Moses berichtet, ist ein Mord: Er beobachtet, wie ein Ägypter einen Hebräer schlägt, also erschlägt er den Ägypter und verscharrt ihn im Sand. Einen Wutanfall bekommt Moses auch, als er nach einem längeren Meeting mit Gott vom Sinai herabkommt und sieht, wie seine Leute fremden Götzen opfern. Moses zerschmettert die Gesetzestafeln, die Gott selbst ihm gab, verbrennt das Goldene Kalb und zerstampft es zu Staub. Es bleibt nicht bei vorsätzlicher Sachbeschädigung: Er macht mit seinen Getreuen alle nieder, die untreu waren: „Zieht durch das Lager von Tor zu Tor! Jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund, seinen Nächsten!“ Ein Blutbad.
Wo er Gottes Weisungen folgt, erreicht Moses bewundernswerte Größe (tapfer vor dem Pharao, weise in der Führung des Volks, ausdauernd), wo er aus Eigenem handelt, wird es brutal und blutig. Am Ende darf das Volk in das von Gott verheißene Land, nur Moses darf es nicht betreten. Stellvertretend für die Seinen ist er vor Gott getreten; stellvertretend für die Seinen muss er büßen. „Von der anderen Talseite aus“ darf er das Ziel seiner Abenteuer, ja seines Lebens, sehen. Immerhin.

Paulus
Der missionarische Choleriker
Ein großer Denker, ein theologisches Schwergewicht, eine Schlüsselfigur der Christenheit, ein dynamischer Workaholic mit unerschöpflicher Power: Die Lebensleistung des Apostels Paulus ist so gewaltig, dass jeder PR-Berater über seine dunkle Vergangenheit geschwiegen hätte. Nicht so die Bibel: Schon seinen ersten Auftritt malt sie in düsteren Farben. Noch bevor wir von seinem brillanten Geist und seinen Verdiensten erfahren, lesen wir von seiner Beteiligung an einem Mord.
So geht es weiter: Der Kerl „versuchte, die Kirche zu vernichten“, er „wütete mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn“. Himmlische Gewalten greifen ein, werfen den Gewalttätigen vom hohen Ross, schlagen ihn mit Blindheit. In Damaskus wird er getauft und geheilt. Nun ist alles gut – aber der Charakter bleibt. „Kraftvoll“ nennt ihn die Bibel, „cholerisch“ würde es auch treffen. Immer wieder trennen sich Weggefährten von dem Heißblütigen.
Aus dem Verfolger wird ein Verfolgter: Er überlebt Mordanschläge in Damaskus, Jerusalem und Anatolien, wird gesteinigt und verprügelt, bedroht und in den Kerker geworfen. Von seinem neuen Kurs ist er nicht abzubringen: Wohin er auch kommt, gewinnt er Anhänger
für Christus. Paulus polarisiert. Knapp der Lynchjustiz entronnen, wird er dem römischen Statthalter so vorgestellt: „Dieser Mann ist
eine Pest, ein Unruhestifter und Rädelsführer.“ Jedenfalls ein Typ mit der Energie, eine Welt
aus den Angeln zu heben. Gott selbst griff ein, ihn auf Seine Seite zu ziehen.

Petrus
Opportunist im entscheidenden Moment
Der erste Papst hatte weder Abitur noch Theologiestudium, war weder Intellektueller noch Karrierist. Petrus war Fischer und wäre das zeitlebens geblieben, wenn Jesus ihn nicht mehrfach nachdrücklich auf eine andere Spur gesetzt hätte. Petrus ist, was man einen „graden Michel“ nennt: aufrecht, ehrlich, erfrischend undiplomatisch, echt. Frei von Eitelkeit, Wichtigtuerei oder Selbstverliebtheit.
Als Jesus seine Jünger fragt, für wen sie ihn halten, platzt es aus Petrus heraus: „Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes!“ Jahrzehnte später wird er für dieses Bekenntnis in Rom zu Tode gefoltert werden. Dort, wo heute der Papst wohnt und die nach Petrus benannte Basilika steht, ließ Nero den Apostel neben vielen anderen Christen kreuzigen.
Einmal aber, ein einziges Mal versagt Petrus total – und die Bibel schildert uns die Details. Zuerst schwört er Jesus die Treue, wenige Stunden später beteuert er, ihn nicht zu kennen. Petrus hatte Jesus versprochen, mit ihm in den Tod zu gehen. Tatsächlich sollte er viel später für ihn sterben. Jetzt aber, in der Leidensnacht Jesu, versagt Petrus. Aus Feigheit und Opportunismus. Er will seine Haut retten. Wer kann es ihm verdenken? Da kräht der Hahn, der Blick seines Herrn und Freundes trifft ihn. Es ist der Blick der enttäuschten Liebe, die alles Verzeihen bereits beinhaltet. Petrus weint: über sein Versagen, das er nicht mehr gutmachen kann. Er nicht, aber Jesus doch: Durch seine Niederlage hindurch erfährt Petrus seine Berufung. Eine Berufung zur Nachfolge – und in den Tod.
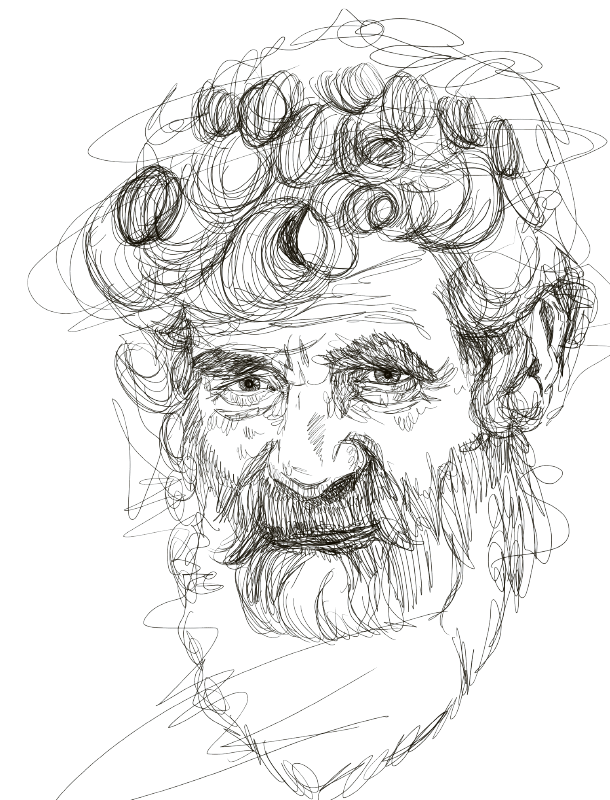
Abraham
Der geschäftstüchtige Überlebenskünstler
Ein Spätzünder oder doch nur ein Spätberufener? Immerhin ist Abraham bereits 75, als Gott in sein Leben tritt, um ihn mit einer ziemlich wuchtigen Zusage aufzufordern, seine Heimat zu verlassen. „Da zog Abraham weg“, heißt es in der Bibel lapidar. Ein Mann voll Gottvertrauen, der handelt, wenn Gott es von ihm verlangt. „Hier bin ich“, antwortet er ohne Umschweife, als Gott ruft. Biblisches Fazit: „Abraham glaubte dem Herrn, und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an.“
Jedes Heldenepos (und jede Wahlkampfbroschüre) hätte es dabei belassen, hätte die Standhaftigkeit, den Gehorsam, die Tapferkeit des Protagonisten gerühmt. Nicht so die Bibel: Statt dieses Vorbild im Glauben maximal vorbildlich zu präsentieren, richtet sie den Scheinwerfer voll auf sein Versagen: In aller Breite erzählt uns die Bibel, wie Abraham aus Angst um sein Leben seine bildhübsche Frau als seine Schwester ausgibt. Er überlässt seine eigene Frau dem ägyptischen Pharao! Ja er kassiert dafür sogar reichlich Schafe und Ziegen, Rinder und Esel, Knechte und Mägde. Gott gefällt das gar nicht, wie wir uns denken können. Aber auch der Pharao ist am Ende sauer: „Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist?“
Abraham ist ein geschickter Geschäftsmann und Verhandler, ein Dealmaker. Sogar mit Gott feilscht er. Nicht durch Kriege und Eroberungen, sondern durch Geschäfte und Verhandlungen bringt er es zu einem stattlichen Besitz. Seine Feigheit und Unaufrichtigkeit wird uns nicht verschwiegen. Erst nach und nach reift er in hohem Alter zu menschlicher Größe und – geführt durch einen geduldigen Gott – zu grenzenlosem Gottvertrauen.
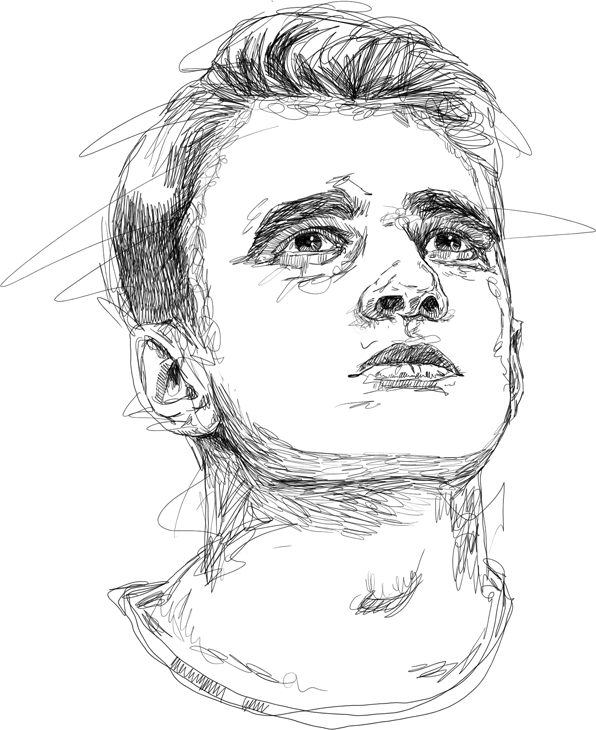
Jona
Ein Prophet ertrinkt in Selbstmitleid
Herr Jona ist wie der sprichwörtliche Hund, den man zum Jagen tragen muss. Gott gibt ihm einen Auftrag, aber er rennt weg – „weit weg vom Herrn“, was irgendwie eine putzige Vorstellung vom Allmächtigen verrät. Kein Wunder, dass das Schiff, auf dem er fliehen will, in arge Seenot gerät. „Nehmt mich und werft mich ins Meer“, sagt Jona schuldbewusst. Das klingt heroisch: Da opfert sich einer für alle. Doch diese Deutung geht tiefenpsychologisch knapp daneben: Jona will nämlich gar nicht in erster Linie die anderen retten, sondern selber sterben.
Gott braucht ihn aber noch. Um nun dem depressiven Jona zu zeigen, dass sich für Gott unendlich viele Optionen bieten, wo der Mensch keine mehr sieht, lässt er ihn von einem Fisch verschlingen und (unzerkaut wie unverdaut) drei Tage später an Land spucken. Drei Tage und Nächte im Bauch des Fisches, das gab auch Jona zu denken. Also folgt er ausnahmsweise, geht nach Niniveh und droht – wie Gott es wollte – dem dortigen Sauhaufen das göttliche Strafgericht an. Niniveh müssen wir uns etwa so vorstellen wie Hamburg Reeperbahn oder Frankfurt Kaiserstraße.
Jona also predigt Untergang – und da passiert das total Unwahrscheinliche: Die Leute glauben ihm! Sie bekehren sich, tun Buße! Alles gut, könnte man meinen. Aber statt zu jubeln oder sich wenigstens zufrieden zurückzulehnen, weil seine Drohbotschaft wirkte, versinkt Herr Jona in Selbstmitleid. Er, der selbst vor Gott davonlief, nimmt es seinem Gott jetzt übel, dass Er die bekehrten Niniviten nicht einfach niedermacht. In seinem Trotz wird Jona richtig besserwisserisch: „Ach Herr, habe ich das nicht gesagt, als ich noch daheim war?“ Wieder will er sterben.
Alle hat Gott bekehrt, die durchgeschüttelte Schiffsbesatzung und die enthemmten Niniviten. Jetzt muss er sein unfähiges Werkzeug Jona noch bekehren. Weil die Sonne gar heiß auf dessen Schädel brennt, lässt Gott einen Schatten spendenden Strauch wachsen – und Jona freut sich. Dann lässt Gott den Strauch verdorren – und Jona will wieder einmal sterben. „Ja, es ist recht, dass ich zornig bin und mir den Tod wünsche!“, sagt Jona in trotzigem Selbstmitleid. Was für ein egozentrischer Jammerlappen! Aber Gott, dessen Geduld so unendlich ist wie seine Macht, ist mit dem kleinen Jona nicht weniger barmherzig als mit den bekehrten Einwohnern Ninivehs.
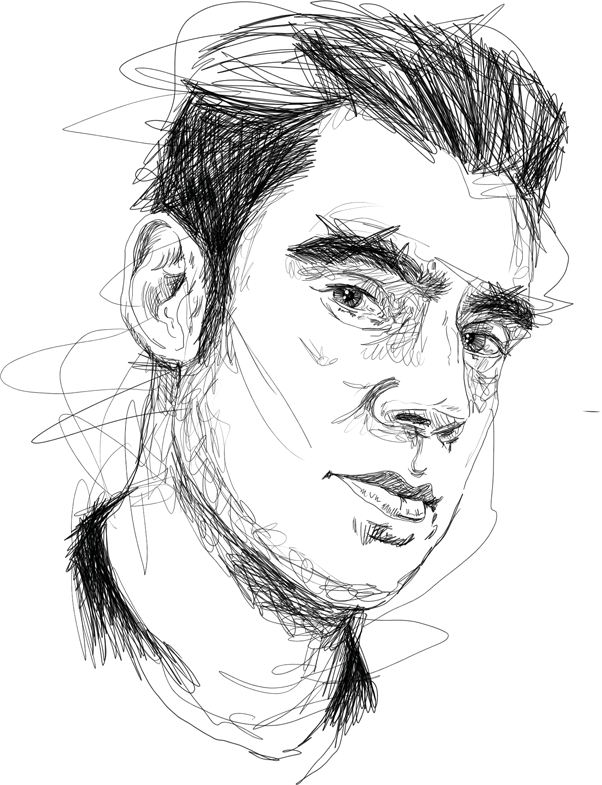
Thomas
Ein moderner Skeptiker
Sorry, aber den Apostel Thomas muss ich gegen die Bibel und all die Frommen in Schutz nehmen. Die Heilige Schrift behandelt ihn weitgehend wie einen Statisten, aber den einen kurzen Moment des begründeten Zweifels baut sie literarisch so aus, dass der arme Mann allen Christengenerationen seither als „ungläubiger Thomas“ in Erinnerung ist. Das ist so unfair!
Wir müssen uns die Sache so vorstellen: Jesus wurde brutal zu Tode gefoltert und bestattet. Seine Freunde sind total am Boden, deprimiert, verzweifelt, verängstigt. Das große Projekt scheint gescheitert, ihr Leben ist in Gefahr. Da erscheint ihnen Jesus, eben von den Toten auferstanden, spricht mit ihnen, segnet und sendet sie. Einer aber ist gerade nicht da: Thomas. Als ihm die anderen später euphorisch berichten, ihnen sei Jesus begegnet, da reagiert er, wie jeder halbwegs vernünftige Mensch reagieren würde: Hey Leute, was habt ihr denn geraucht? Oder so ähnlich. Thomas ist nicht „ungläubig“, sondern einfach vernünftig, realistisch, pragmatisch. Die Sache mit der Auferstehung schien ihm damals so logisch wie ein Fußballspiel mit Marsmännchen.
Thomas war nicht ungläubig, aber er war auch nicht leichtgläubig. Er zweifelte nicht an Jesus, sondern an der Zurechnungsfähigkeit seiner Freunde. Das hätten wir doch auch! Als Jesus ihm dann großzügigerweise persönlich erscheint (nicht als Geist, sondern leiblich anfassbar), da zögert Thomas keinen Augenblick. „Mein Herr und mein Gott!“ Voll Glauben zieht Thomas los – weiter als alle anderen. Bis nach Indien, damals das vermutete Ende der Welt, trug er den Glauben an Jesus Christus. Bis heute heißen die traditionsreichsten Christen im Süden Indiens „Thomaschristen“.
Todesmutig war dieser Thomas immer schon: Als Jesus über seinen eigenen Tod sprach, forderte Thomas die anderen Jünger auf: „Dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben.“ Im indischen Madras soll er, so sagt die Legende, durch einen feindlichen Speer ums Leben gekommen sein. Wir glauben es gerne. Auch ohne den Finger in seine Wunden zu legen.
Gott sucht keine Fehlerlosen
Wer allzu perfekt ist, taugt nich t zum Vorbild. Wenn wir einem Fehlerlosen nach laufen, stolpern wir nur über unsere eigenen Schwächen und Fehler. Die Bibel macht das wohl mit Absicht, dass sie uns die Momente der Schwäche und des Versagens bei den ganz Großen deutlich zeigt. Sie hält den Scheinwerfer frontal auf das Versagen der Vorbilder. Damit wir nicht frustriert werden, sondern erkennen: Gott braucht keine Fehlerlosen, sondern normale Menschen – Leute wie Dich und mich.
Zu Vorbildern wurden die Großen der Bibel, als sie sich vom Allergrößten in den Dienst nehmen ließen. Ein Talent des Dienens kann jeder haben, denn so viel gehört ja nicht zur Erkenntnis, dass es Größeres gibt als unser kleines Ego – und dass wir an Größe gewinnen, wenn wir dem Guten, Wahren und Schönen dienen.

