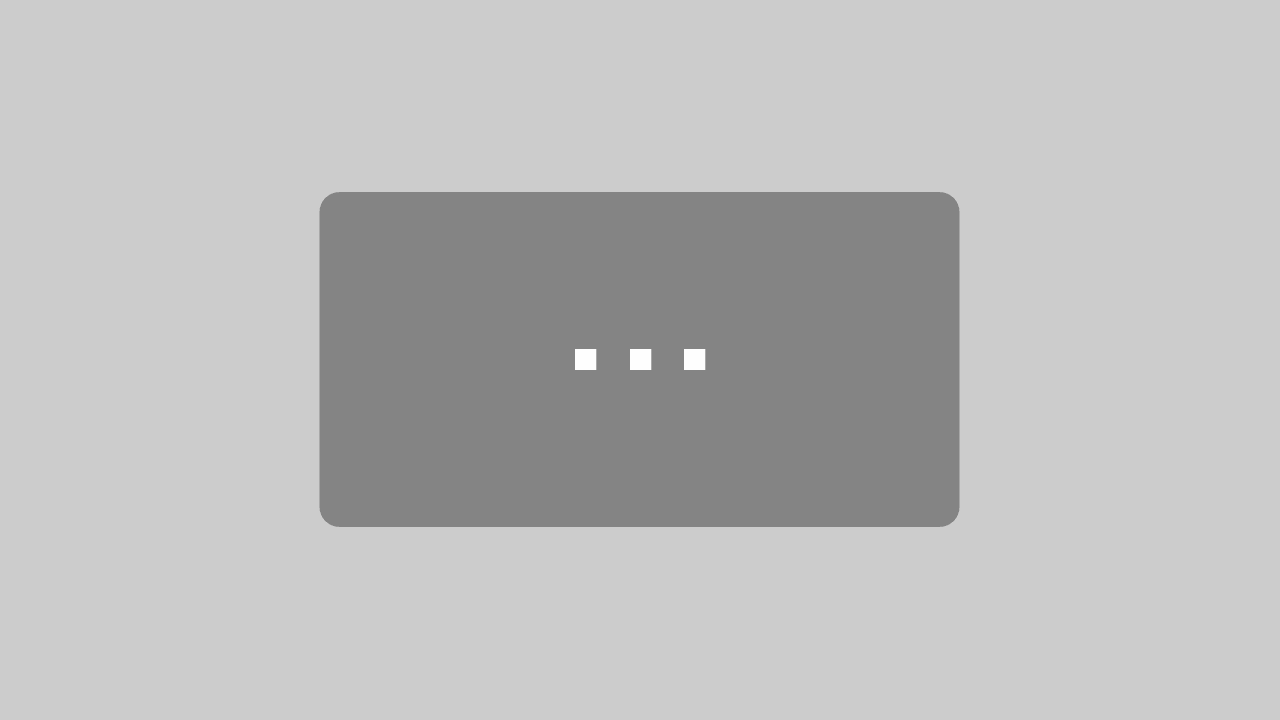Lesedauer: ca. 6 Min.
Autor: Ulrich Brodersen | Bilder: Bernhard Spoettel, Familienarchiv
Als der Tod zur Unzeit kam
Die Diagnose war ein Schock: Hirntumor. Nur 20 Tage später war Jens tot. Er wurde 26 Jahre alt.
Sein Vater schreibt über das Drama des Verlustes und Kraftquellen inmitten von Entsetzen und Trauer.
Ein Versuch, das Unbeschreibliche in Worte zu fassen.
Was wohl werden würde, wenn eines meiner beiden Kinder vor mir stürbe? Wenn mir früher mal ein solcher Gedanke kam, wurde mir ganz anders. Und wechselweise sah ich mich arbeitsunfähig vor mich hin vegetieren oder gleich in die Psychiatrie einrücken. Schnell lenkte ich meine Gedanken wieder auf Alltäglicheres. Im Sommer 2013 geschah dann tatsächlich das Ungeheuerliche – mir beinahe noch so gegenwärtig, als wäre es in den vergangenen Tagen gewesen: Bei Jens, meinem 26-jährigen Sohn, entwickelten sich unspezifische heftige Kopfschmerzen, Übelkeit bis zum Erbrechen, schließlich auch Koordinations- und Gedächtnisprobleme. Die neurologische Untersuchung ergab einen Gehirntumor – bis dahin der größte Schock unseres Lebens. Es folgten eine ganztägige OP und der Gewebebefund: unheilbar! Nach der Narkose verblieb Jens im Koma. Am 24. Juli, 20 Tage nach der Diagnose, trat der Hirntod ein. Bis der Tumor kam, war sein Leben sehr vielversprechend verlaufen.
Hoffnungsschimmer an einem dieser grausamen Tage
85 Prozent der Menschen in Deutschland, so sagt eine Statistik, die oder deren nahe Angehörige lebensbedrohlich erkranken, finden ins Gebet. So war es auch bei Jens, für den Christus und die Kirche nicht die sein Leben bestimmenden Leitsterne gewesen waren, in seinen letzten bewusst erlebten Tagen. Ich hingegen gehörte zu den restlichen 15 Prozent. In meiner Verstörtheit und Verzweiflung stand mir nicht der Sinn danach, Gott zu danken oder zu preisen. Und ihn zu bitten, Jens wieder gesund zu machen, wäre mir kindisch vorgekommen.
Zwar war ich in der zweiten Hälfte meiner 30er Jahre ganz allmählich Christ geworden. Eine diffuse Sehnsucht, wahrgenommen als unbestimmtes Mangelempfinden, hatte mich seit meiner Kindheit begleitet. Sie war durch nichts auf dieser Erde zu stillen. Das hatte die Erkenntnis reifen lassen: Es gibt doch für alle starken Antriebe Möglichkeiten der Erfüllung, also sicher auch für diese Sehnsucht. Hinter ihr steckte der unaufhebbare Wunsch, Teil von etwas Größerem zu sein. Als mir deutlich wurde, es war die Sehnsucht nach dem Reich Gottes, kehrte mehr innere Ruhe ein. Denn seitdem glaube ich: Da kommt noch was. Aber trotz einigen Bemühens gelang es mir nur selten, die Nähe zu Christus und zu Gott so zu spüren, wie ich mir gewünscht hätte. Das war insoweit die Ausgangslage, als das Entsetzliche über uns kam.

Jens
Aber schon in den Tagen zwischen Diagnose und OP setzte ein Prozess ein, der von Trost und Hoffnung getragen war. Der entscheidende Auslöser dafür war, dass ich Gott in neuer Qualität kennenlernen durfte. Und das kam so: An einem dieser schlimmen Tage zwischen Diagnose und OP sagte Gisela, meine Frau, unvermittelt: „Ich bete ja nicht darum, dass er wieder gesund wird, sondern ,Dein Wille geschehe und gib uns die Kraft, damit weiterleben zu können‘.“
Ja, das ging mir unmittelbar ein. Es war ein Stück Abgeben der unsäglichen Last, phasenweise Befreiung von der kaum auszuhaltenden inneren Unruhe, weniger Auflehnung und dadurch mehr Kraft zur Konzentration auf das, was uns oblag. Es kehrte der in solcher Situation größtmögliche innere Friede ein. Oft sagten wir uns: „Den Tag heute müssen wir wieder schaffen. Mehr müssen wir nicht.“
Wunschdenken hätte nicht weit getragen
Das erste Mal in meinem Leben nahm ich Gebetserhörung wahr: In der Bewältigung dieses Schicksals wuchsen uns übernatürliche Kräfte zu, über die ich noch heute staune. Uns war in dieser Zeit das bekannte Bonhoeffer-Lied ans Herz gewachsen – zuvor ein schönes Kirchenlied, jetzt jede Zeile wie für uns gemacht. Eines Morgens nach dem Aufwachen im Hotel nahe des Krankenhauses, in dem Jens lag – wieder ein schwerer Tag vor uns – empfand ich zutiefst und sagte zu Gisela: „Du, wir sind ja wirklich von guten Mächten wunderbar geborgen.“ Und sie stimmte ohne Wenn und Aber zu.
Es kam also ganz anders, als in früheren Vorstellungen gedacht. In meiner existenziellen Not lernte auch ich mich selbst neu kennen. Heute kann ich sagen: Ich befinde mich derzeit trotz und mit meiner Trauer um Jens in der besten Phase meines Lebens. Das allerdings zu einem horrend überhöhten Preis. Aber der war ja nicht verhandelbar.
Ich weiß, hätte mir jemand anderes dergleichen berichtet, wäre ich voller Skepsis und Zweifel gewesen. Aber Wunschdenken, sich die Welt schön zu reden, hätte uns angesichts des fürchterlichen Geschehens nicht weit getragen. Nein, dieses Erleben war fundamental und substantiell. Mit dem Verstand kann ich mir das nicht erklären und wir konnten dergleichen nicht bewusst herbeiführen. Alles, was wir getan hatten, war, uns durch das Gebet für dieses Geschenk zu öffnen, welches uns etwas stabilisierte und bis heute trägt. So fungierte Gott als elementare Kraftquelle in unserer Not und Trauer. Die durch sein „sich so Zeigen“ enorm gestärkte Glaubenszuversicht machte mir viel präsenter als zuvor: Ja, wir haben eine unsterbliche Seele. Und ja, Jens hat nun schon am ewigen Leben teil. Das ist für mich der denkbar größte Trost.

Und damit war – so nehme ich es in der Rückschau wahr – sozusagen eine Plattform errichtet über dem bodenlosen Trauerschmerz. Wenn ich zeitweise die Kraft fand, sie zu erklimmen, ergab sich ein weiterer Blick mit anderen Perspektiven, als er, der Schmerz, es in seiner bedrückenden Enge und Tiefe zugelassen hätte. Nicht weit genug zwar, um einen Sinn in Jens’ viel zu frühem Sterben zu erkennen oder um überhaupt nach einem solchen Ausschau zu halten. Aber doch ein Blick, ein Sensorium für eine Fülle weiterer, eher irdischer Tröstungsangebote. Daraus erwuchs die Hoffnung, auch im Diesseits, ohne Jens, noch ein lebenswertes Leben vor mir zu haben. Ich entwickelte geradezu so etwas wie eine Sammelleidenschaft für Trostquellen.
Dabei wurde mir auch die Frage wichtig: Dieser Trost – was ist das für ein eigentümliches Phänomen? Vor 100 Jahren hat Georg Simmel, einer der Begründer der Soziologie, darauf eine treffliche Antwort gefunden: „Trost ist etwas anderes als Hilfe … der Trost ist das merkwürdige Erlebnis, das zwar das Leiden bestehen lässt, aber sozusagen das Leiden am Leiden aufhebt, er betrifft nicht das Übel selbst, sondern dessen Reflex in der tiefsten Instanz der Seele.“
Der direkteste Weg, mir zusätzlich zum Leid über den Verlust meines Sohnes (als ob das noch nicht reichen würde) auch noch dieses „Leiden am Leiden“ aufzuladen, wäre gewesen, mich selbstquälerisch mit der fruchtlosen „Warum-Frage“ abzuplagen: „Warum gerade er, warum gerade wir?“ Ich war froh, dass es mir gelang, diese Frage zurückzuweisen und mir nicht das zusätzliche Leid darüber aufzuladen, dass mir beschieden ist, Leid zu tragen. Aus mehr sachlich-nüchternen Erwägungen habe ich ohnehin einen Widerwillen gegen solche Fragen: Jahr für Jahr sterben in Deutschland etwa 20.000 junge Menschen. Welchen triftigen Grund sollte es geben, dass nicht auch die eigene Familie davon betroffen sein kann?Entsprechende Hoffnung hatte ich natürlich. Seit sie sich als trügerisch erwiesen hat, bin ich jedes Mal angsterfüllt, wenn Gisela oder Barbara, unsere Tochter, aus mir unerklärlichen Gründen nicht erreichbar sind.

„Ich weiß ja nicht, ob ich euch immer dankbar genug war.“
Wie Georg Simmel sagt: Trost beseitigt nicht das Übel. Das Leid bleibt. Und wir Menschen benötigen Trost, weil Leid essentieller Bestandteil unseres Daseins ist. Trost und Untröstlichkeit bestehen nebeneinander. Ich erkläre mir das sinnbildhaft am Beispiel einer chronischen körperlichen Erkrankung: Die Krankheitsursache lässt sich nicht beseitigen. Für diese Unheilbarkeit steht die Untröstlichkeit. Aber der Schmerz als Krankheitssymptom kann, etwa durch Medikamente, eingedämmt, tragbar gemacht werden. Für die wirksamen Schmerzmittel stehen meine Trostquellen. Weitaus grausamer als Untröstlichkeit ist die Trostlosigkeit, wenn Trauernde sich gegenüber jeglichen Trostquellen verschließen.
Meine erste Trostquelle nach Gott war Jens selbst. Genauer die Stärke, mit der er sein Schicksal trug. Seine letzten bewusst erlebten Tage verbrachte er in der Ungewissheit, wie die OP ausgehen und was aus ihr folgen würde. Natürlich war ihm schwer ums Herz. Aber mehrmals an diesen Tagen sagte er: „Für mich als Betroffener ist es gar nicht so schlimm, wie ihr denkt. Ihr habt es jetzt schwerer als ich. Wenn es schiefgeht, bin ich ja weg. Aber ihr müsst damit klar kommen. Hoffentlich müsst ihr dann nicht zu sehr leiden.“ Und am Abend vor der OP, als ich ihn fragte, ob wir noch etwas zu klären haben, ob wir im Reinen miteinander sind, sagte er, für mich aufwühlend bis heute: „Ich weiß ja nicht, ob ich euch immer dankbar genug war.“
Es steht für uns außer Frage, dass aus unserem Sohn und Bruder eine Stärke und Reife sprach, die uns ein Vermächtnis ist, aus der wir Kraft schöpfen dürfen. Ja, er erwartet geradezu von uns, dass wir im Leben bleiben und dessen Fülle nach unseren besten Möglichkeiten ausschöpfen. Eine Verpflichtung, die ich nicht als Bürde empfinde.

Die dritte Flasche einer edlen Bordeaux-Lage aus dem Geburtsjahr von Jens. Sie wäre geöffnet worden, wenn er geheiratet hätte. Die ersten beiden wurden gemeinsam mit ihm bei seiner Konfirmation und bei seiner Schulentlassung geöffnet.
Für mich ergab sich eine Fülle an weiteren Trostquellen, aus denen ich Hoffnung und Lebensenergie schöpfen konnte: Durch andere Menschen, glückliche Umstände und auch durch die Lektüre von Trauerliteratur. Und im überlebenden Teil der Familie wurden wir uns gegenseitig zu Stabilitätsankern. Wenn einer gerade schwach war, waren die anderen stark. Zu einem wichtigen Trostverstärker wurde Dankbarkeit.
Eines Tages sagte Barbara: „Für mich war es ja besser, dass ich 26 Jahre lang einen Bruder wie Jens hatte, als wenn ich ein Einzelkind geblieben wäre.“ Und wie viele Menschen gibt es, deren sehnlicher Kinderwunsch unerfüllt bleibt?
Wenn verwaiste Eltern anklagend fragen, womit sie ihr schlimmes Schicksal bloß verdient hätten, gehört eigentlich auch die Frage dazu: „Womit habe ich es verdient, dass ich dieses Kind haben durfte?“ Eine in diesem Sinn erweiterte Perspektive scheint mir wesentlich für einen heilsamen Trauerweg zu sein. Für meinen weiteren Lebensweg ebenfalls als wesentlich empfinde ich, dass ich schon bald, nachdem Jens begraben war, meine Trauer nicht nur (er)lebte, sondern sie in manchen Momenten auch betrachtete. Dabei erspürte ich in mir zwei grundlegende Bedürfnisse: Meine Liebe zu Jens zu erhalten und neue Orientierung für mein weiteres Leben zu finden. Denn in mir war sozusagen kein Stein auf dem
anderen geblieben.

Die beste Phase meines Lebens
Jens nahe bleiben – ein Thema für sich. Dabei am wichtigsten sind mir meine fast täglichen Besuche an seinem Grab – als Abstecher auf meiner Joggingrunde. Dort spreche ich mit ihm und bete für ihn. Und schnell wurde mir klar: Ich musste so bald wie möglich raus aus dem Beruf. Ich hatte ein gutes, erfüllendes Berufsleben gehabt. Aber nun galten andere Prioritäten. Beschäftigung mit den existenziellen Lebensthemen – theoretisch und praktisch – steht seither für mich an. Gisela und ich nahmen an Trauergruppen teil. Ich wurde selbst Trauerbegleiter und bin seitdem ehrenamtlich als solcher tätig.
„Trauern ist Leben in Seelentiefe“, so lautet ein Wahlspruch des Instituts für Trauerarbeit in Hamburg, bei dem ich die Ausbildung absolvierte. Er bringt auf den Punkt, was ich frühzeitig empfunden hatte. Diese Seelentiefe möchte ich mir erhalten, auch wenn mein eigener Trauerschmerz allmählich an Dominanz verliert. Anderen Trauernden nahe zu sein, hilft mir dabei. Nur näherungsweise vermag ich so zu beschreiben, wodurch ich empfinde, derzeit meine beste Lebensphase zu haben. Auf alles, was dazu beiträgt, kommt obendrauf seit dem 23. Dezember 2016 noch eine Extraportion Lebensenergie: mit Carla, meiner Enkeltochter. Und im August diesen Jahres dürfen wir einen Enkelsohn erwarten. Dass die beste Zeit aber auch die schönste sein könnte – dazu fehlt Jens einfach zu sehr. Die Wehmut bleibt.