
Lesedauer: ca. 12 Min.
Autor: Jürgen Liminski | Fotos: Bernhard Spoettel
„EIGENTLICH WAR ER IMMER DA.“
Nennen wir sie Fatima. Sie war Muslimin, ist zum Christentum konvertiert und lebt heute in Deutschland. Fatima ist ein Pseudonym, das wir für ihren persönlichen Schutz benutzen, denn ihren wirklichen Namen zu nennen, könnte für sie gefährlich sein. Irgendwann, sehr früh, hat Fatima im Herzen eine himmlische Hand gespürt, sie ergriffen, gehalten und sich führen lassen. An dieser Hand der Freundschaft geht sie durchs Leben.
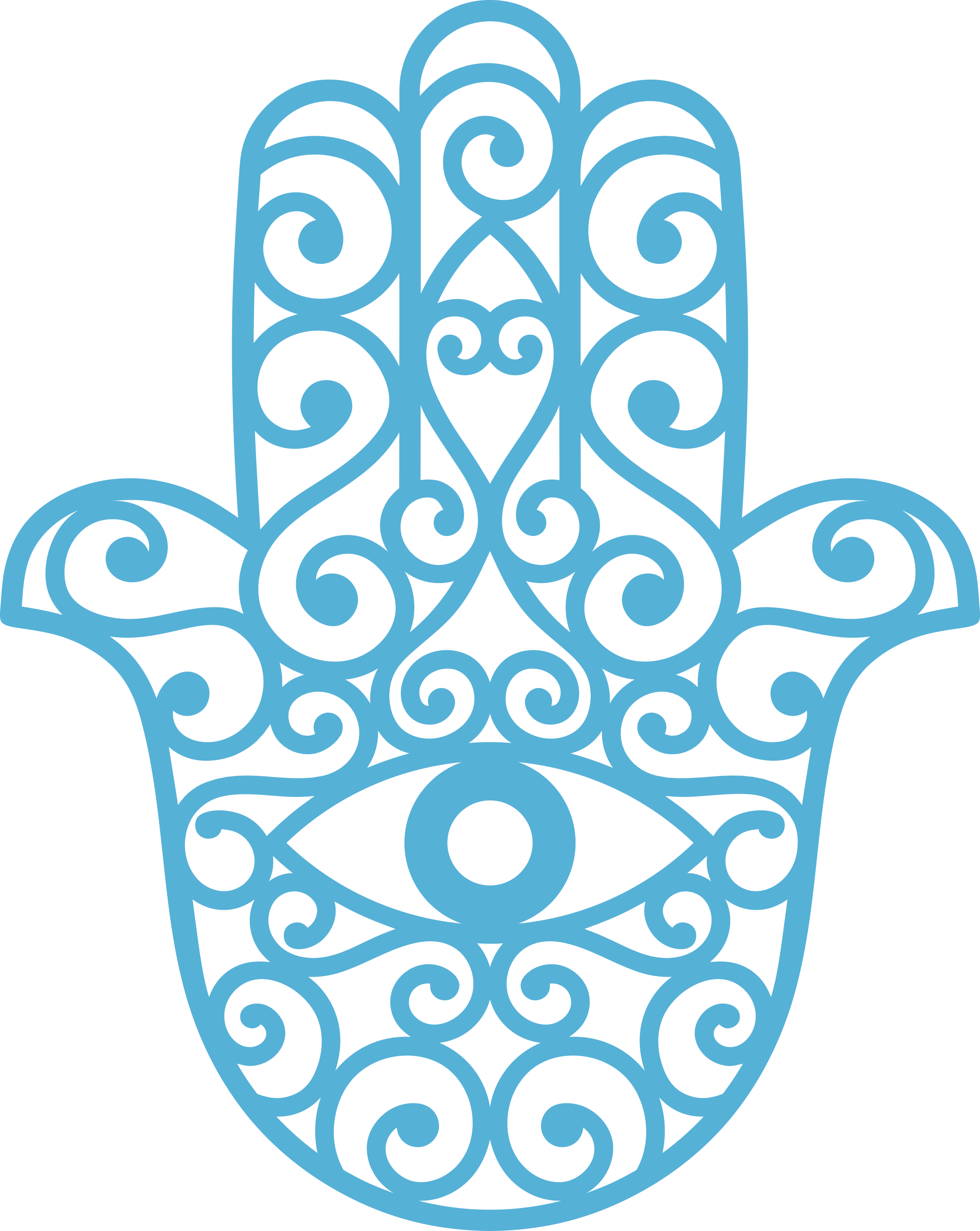
Sie ist zwei Jahre alt, als ihre Eltern aus Marokko nach Deutschland kommen. Mit fünf Jahren, im Kindergarten, fällt ihr auf, dass die Kinder anders sind. Vor allem an Weihnachten. Die anderen bekommen Geschenke, sie nicht. Die anderen essen Schweinefleisch, sie muss immer fragen, auch bei Freundinnen, und dann ablehnen. Sie empfindet das als Selbstausgrenzung. Sie will auch Geschenke, die Eltern geben nach, es gibt ein Fest der Liebe mit Weihnachtsbaum, Gänsebraten und Geschenken. Das war der erste Einbruch in die muslimische Mauer zuhause. Dann, in der Schule, erste ernste Fragen. Aber die Eltern „haben mit mir nie groß über das Christentum diskutiert. Sie sagten: Wir sind Muslime, daran glauben wir und da draußen ist die Welt böse. Und alle Freunde, die du kennst, sind eigentlich keine Freunde“. Fatima akzeptiert es. Aber in der Pubertät tauchen die Zweifel wieder auf, werden größer und konkreter.

Sie will den Koran lesen, den Glauben der Familie, der Eltern näher kennenlernen. „Auch wenn man einer anderen Religion zugehört, möchte man ja eine eigene Beziehung zu Gott aufbauen und nicht nur quasi die Beziehung der Eltern übernehmen“. Mit der Lektüre des Koran stellen sich neue, kritische Fragen. Die Diskussion mit den Eltern wird schwieriger. Sie weichen aus. Den Koran könne man nur in Arabisch wirklich verstehen. Aber Fatima hinterfragt den Inhalt, nicht die Form. „Das stimmte überhaupt nicht mit meinem Gottesbild überein, ich hatte ja schon eine Beziehung zu Gott. Eine sehr gute und lebhafte Beziehung und dann las ich auf einmal, wie Gott sein sollte und ich dachte: So erlebe ich Gott gar nicht“. Fatima will wissen, es ist auch ein Disput mit dem eigenen Gewissen.
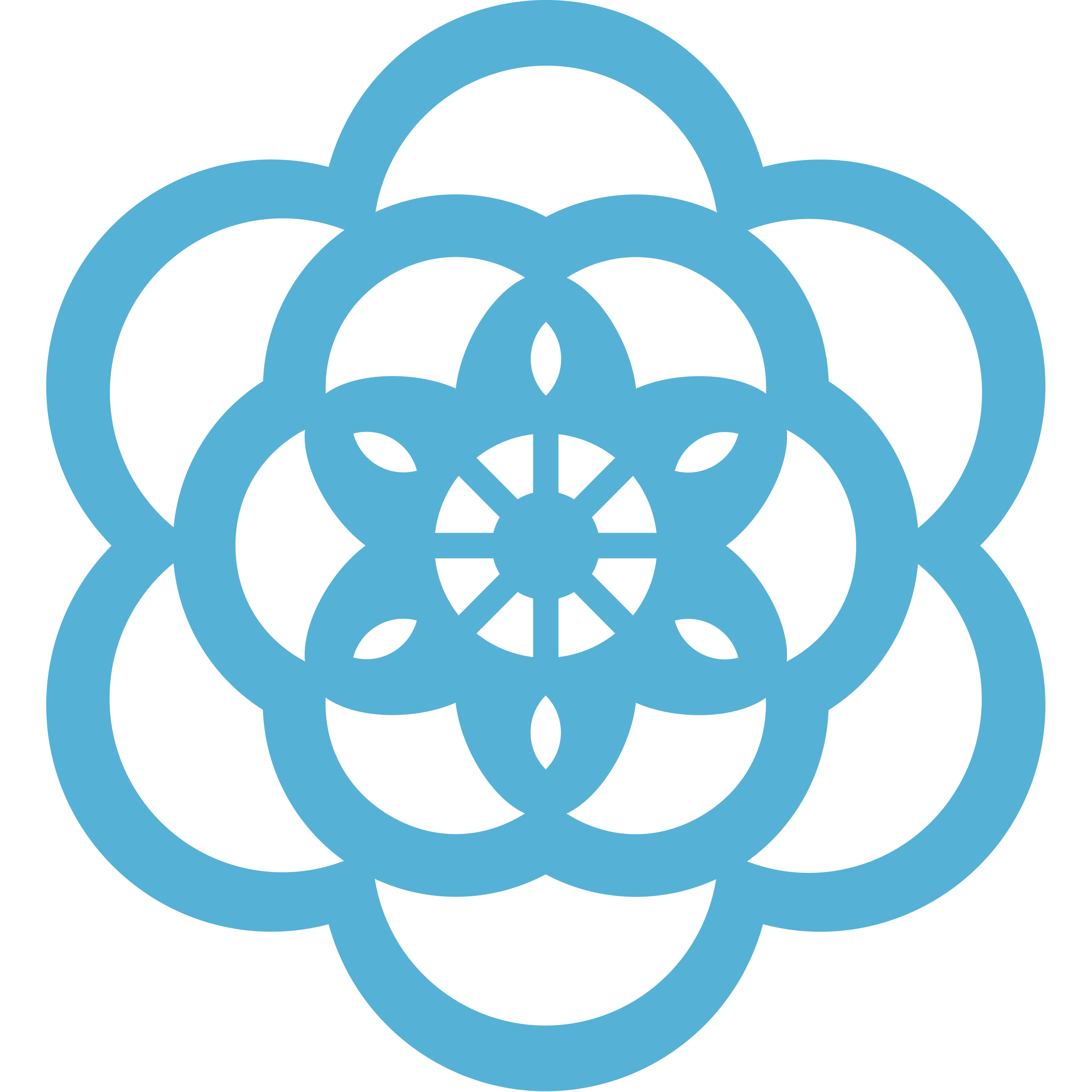
„Fragen ist doch ein Zeichen von Interesse.“
Die Eltern halten das Hinterfragen für eine Phase der Pubertät. Es kommt zu Diskussionen, „die dann aber schnell abgewürgt werden. Meine Mutter hat mir den Mund verboten, bevor ich überhaupt die Frage zu Ende stellen konnte“. Fatima versteht das noch heute nicht. „Ich finde, fragen ist doch ein Zeichen von Interesse“. Das Abblocken steigert bei ihr nur die Neugier. Die Neugier wird zur Sehnsucht. Eine Begegnung mit Christus? „Eigentlich nicht. Ich hatte immer das Gefühl, Gott zu kennen, nur konnte ich ihn nicht so richtig abgleichen“. Dann liest sie das Neue Testament „und dort habe ich ihn gefunden. Aber das war viel später, das hat sehr lange gedauert. Man glaubt es gar nicht, man wächst in einem christlichen Land auf und kennt die Bibel nicht. Ich hatte damals, ausgelöst von einer Hochzeit katholischer Freunde, das Gefühl, du musst das Neue Testament lesen“. Sie nimmt und liest. Und erkennt: „Ja, das ist es. Das ist mein Gottesbild, was hier beschrieben wird“.
Sie liest die Bibel von vorne bis hinten. „Wenn man die Geschichte noch nicht kennt, dann leidet man ja mit Jesus mit. Man weiß ja nicht, dass er stirbt und wieder aufersteht. Das war alles neu für mich“. Viele Passagen fesseln sie, „aber die, die mich am meisten gepackt hat, war die Passionsgeschichte. Dieses Leiden für uns. Und dass Jesus so viel Leid erträgt und theoretisch ja in seiner Göttlichkeit etwas dagegen tun könnte, aber es nicht macht. Diese Größe in der Schwachheit. Und wie er das umsetzt. Vorher, in der Bergpredigt, liest man, ,liebt eure Feinde‘ und man denkt: Ja, natürlich. Schwierige Sache, aber ja, sollte man. Und dann liest man die Passion und erkennt, was das in der letzten Konsequenz heißt. Ich war so berührt davon und habe gedacht: Das kann nur Gott so machen. Das war der Punkt, ich sagte mir: Was hier drinsteht, ist einfach wahr.“
GEFÜHLSRAUSCH
Es war ein Emmaus-Erlebnis. So wie den Jüngern von Emmaus brannte Fatima das Herz. „Als ich die Stelle von den Emmaus-Jüngern im Evangelium gelesen habe, das erste Mal, habe ich gedacht, denen geht es genauso wie mir, das ist absolut das, was ich fühle.“ Sie erinnert sich, wie sie oft nach der Lektüre dieser und anderer Passagen innerlich den Drang hatte, „ich will raus in die Welt, die Menschen rütteln und sagen: Wisst ihr das eigentlich?“. Sie ist begeistert und fragt sich: „Wie können Christen, die ich ja kenne, mir das nie erzählt haben und nicht so Feuer und Flamme sein und es anderen Menschen erzählen.“ Ihre Begeisterung ist grenzenlos, „eine Art Gefühlsrausch, ein Angezündetsein für Gott“. Dennoch bleibt sie skeptisch gegenüber Formen mystischer Selbstaufgabe, denn „das ist ja gerade das Besondere am Christentum, dass es ein Du gibt, was mich liebt. Erst mit dem Ich und dem Du entsteht eine Beziehung und deswegen bin ich kein Fan von Mystikern, die sagen, es ist wichtig, dass ich lerne, mich in dem Göttlichen aufzulösen. Ich glaube aber, dass man bei einer intensiven Beziehung mit Gott von ihm etwas erhoben wird über diese Welt und dass man dann Dinge anders sieht und Gott einem die Möglichkeit schenkt, größere Zusammenhänge zu erkennen“.
Ob Mystik, Begeisterung oder kühle Ratio – es geht um eine Beziehung. „Um eine Liebesbeziehung, um Freundschaft mit Gott.“ Für Fatima liegt hier einer der großen Unterschiede zum Islam und zwar im doppelten Sinn. „Zum einen gibt es im Islam ein ganz anderes Gottesbild, es ist nicht der personale Gott, der sich klein gemacht hat, weil er uns so sehr liebt, sondern es ist nur ein transzendentes Wesen, ganz weit weg, sehr erhaben und das eigentlich so gar nichts mit uns zu tun hat. Zum zweiten ist es das Menschenbild. Im Christentum sind wir nicht nur Freunde Gottes, sondern Kinder Gottes. Im Islam ist man Diener oder Sklave, im Christentum ist man erlöst durch die Liebe Gottes. Im Islam geht es nicht darum, von Gott geliebt zu werden, sondern eine gewisse Leistung zu erbringen.“
Fatimas positive Grundstimmung gegenüber Gott widerspricht dem islamischen Gottesbild, wie sie es kennengelernt hat. Diese Freundschaft war aber schon früh da. Woher kam sie, durch die Liebe der Eltern oder der Familie? „Vom lieben Gott selber, würde ich behaupten. Denn ich kann das gar nicht sagen. Ich habe es nirgendwo gelernt. Weder in meiner Familie noch im weiteren familiären Umfeld und auch nicht bei christlichen Freunden, weil diese Freunde ihren Glauben gar nicht so gelebt haben. Es war einfach da. Ja, in dieser sehr einsamen Welt, in der ich als Kind gelebt habe, war Gott so der Freund, den ich hatte, der da war, damit ich nicht alleine war.“
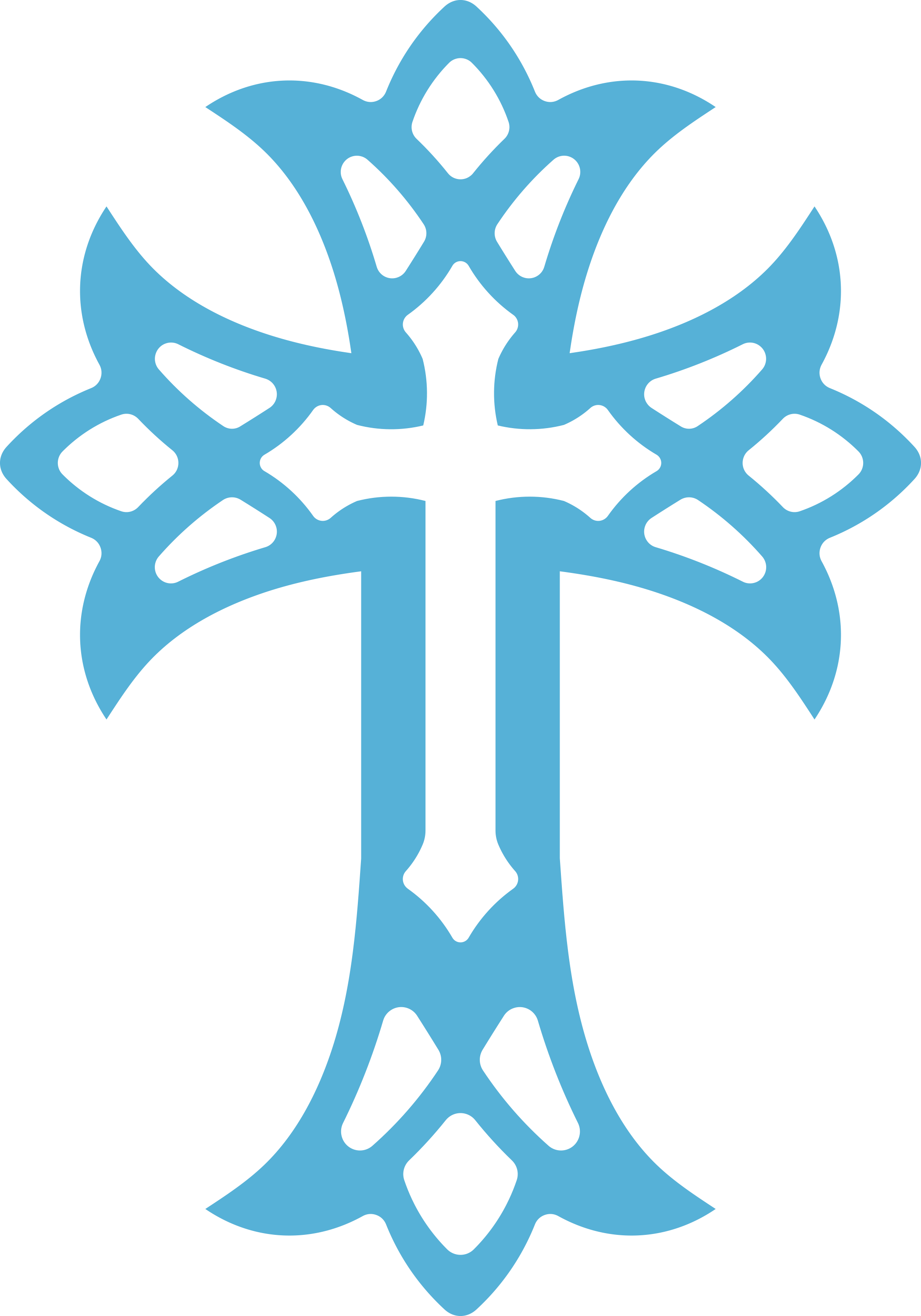
„Wenn wir anderen Menschen helfen und die Liebe Gottes mit anderen Menschen teilen. Das ist quasi unser Teil an dieser Freundschaft.“
Freund Gottes sein, als Kind Gottes leben. Fatima hat oft darüber nachgedacht. Sie sieht das Freundschaftliche an der Beziehung zu Gott vor allem in seiner Gegenwart, im Hier und Heute. „An ganz vielen Stellen sagt er: ,Ich bin da, fürchtet euch nicht‘. Sogar er selbst sagt von sich: ,Ich bin der, ich bin da‘. Und das ist für mich das, was Freundschaft ist: da sein.“ Aber das sei keine Einbahnstraße. „Auch wir sind da für Gott“, und das zeige sich an unserem Verhalten zu den anderen, „an einer Stelle heißt es deswegen: Was du für den geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan“. Hier könne der Mensch die Freundschaft Gottes erwidern, „wenn wir anderen Menschen helfen und die Liebe Gottes mit anderen Menschen teilen. Das ist quasi unser Teil an dieser Freundschaft“.
Das sei auch mehr als soziales Verhalten. Denn dahinter stehe eine ganz persönliche, individuelle Beziehung, „insofern, dass Gott nichts Abstraktes ist, irgendwo da oben im Himmel, sondern ein Gesprächspartner, jemand mit dem ich Zeit verbringe, jemand dem man seine Sorgen anvertrauen kann, ein Wegbegleiter“. Im Alten Testament, im Buch Exodus, wird gesagt: Der Herr und Mose redeten miteinander, Auge um Auge, wie ein Mensch zu seinem Freunde spricht. Steht der Mensch auf gleicher Augenhöhe mit Gott? Fatima zögert mit der Antwort: „Also, ich möchte das über mich nicht sagen. Aber ich würde sagen, dass es möglich ist, auf Augenhöhe mit Gott zu sprechen. Ich glaube, auf der einen Seite hat Gott sich in Jesus kleingemacht und ist Mensch geworden und kann nachvollziehen, was es heißt, Mensch zu sein und unsere Probleme und Sorgen und Freuden zu haben. Auf der anderen Seite, glaube ich, dass es für den Mensch möglich ist, immer heiliger zu werden und immer mehr nach Gott zu streben. Ich glaube, ein Mensch, der sich quasi in Gottes Richtung bewegt, dem ist es möglich, auf Augenhöhe mit Gott zu sprechen.“

Fatimas Umgang mit Gott, dem Freund, „ist wie bei jeder Freundschaft: viel Zeit miteinander verbringen und sich einfach gut zu kennen. Ich persönlich habe zwei feste Gebetszeiten am Tag, morgens und abends. Damit es nicht untergeht in der Hektik, nehme ich mir da bewusst Zeit. Ich glaube aber auch, dass ein großer Teil des Gebetes ist, einfach mit Gott zu sprechen, so wie der Schnabel einem gewachsen ist und dafür muss ich keine Kerze anzünden. Das kann im Guten und Schlechten passieren, das kann sein, dass man seine ganze Wut Gott hinwirft“. Sie schimpfe auch mit Gott, das sei auch „eine Art des Gebets. Und, ja, warum nicht? Natürlich gibt es Leid, natürlich regt man sich auf und das mit Gott zu teilen, ist Gebet“. Freilich sollte man auch nicht vergessen, schöne Momente mit Gott zu teilen und dafür zu danken. Das täten Freunde auch. Und das sei auch eine Form des Gebetes.
Fatima ist verheiratet. Was sagt ihr Mann zu ihrem Weg? Ist er gar eifersüchtig auf Gott? „Nein, überhaupt nicht. Wir haben uns vor drei Jahren gemeinsam taufen lassen, er war evangelisch erzogen worden, aber nie getauft. Insofern war er schon gläubig und er kam von sich aus zu der Erkenntnis, sich mit mir katholisch taufen zu lassen. Als wir das damals zu zweit gemacht haben, war das unser einzelnes persönliches Ja zu Gott. Letztes Jahr haben wir uns dann katholisch trauen lassen und sind, wie es in der Bibel so schön heißt, ein Fleisch geworden. Und gemeinsam haben wir dann ja zu Gott gesagt, also als Gemeinschaft, und deswegen führen wir quasi eine Ehe zu dritt, Gott ist bei uns der Dritte im Bunde. Das wünsche ich allen katholischen Ehen.“
„Glück kommt und geht. Es ist eine Gnade, die man geschenkt bekommt.“
Manchmal sagten ihr Freunde: „Jetzt, da du Gott gefunden hast, musst du ja ständig glücklich sein“. „Ein Trugschluss“, meint Fatima. Gott sei „kein Glücklichmacher, dafür ist er nicht da. Das wäre eine Dienstleistung, die ich dann erwarte und das fände ich total schwachsinnig“. Viele Freundinnen sagten ihr: Wenn mein Mann mich nicht mehr glücklich macht, dann verlasse ich ihn. Und es gäbe viele Menschen, „die über Gott ähnlich denken: Ah, wenn Gott mich nicht mehr glücklich macht, dann trete ich aus der Kirche aus. Was soll ich dann damit?“ Für Fatima geht es nicht um glücklich sein im Leben und auch nicht im Glauben. „Glück kommt und geht. Es ist eine Gnade, die man geschenkt bekommt, aber es kann nie ein Ziel sein. Ich glaube, das Ziel eines christlichen Lebens ist nicht das persönliche Glück, sondern die Welt ein bisschen besser zu hinterlassen, wenn man geht.“ Jeder habe eine persönliche Aufgabe von Gott und „unsere Aufgabe ist, zu entdecken was wir hier tun sollen und es zu machen und dabei können wir glücklich werden oder nicht, aber das ist im Endeffekt egal“. Denn „das Einzige, was immer bleibt, egal was passiert, sind Gott und unsere Beziehung mit Gott und deswegen finde ich, sollten wir uns um die viel mehr kümmern“.


