Autor: Stephan Baier | Illustrationen: Carina Crenshaw
Der Mensch
Das etwas andere Säugetier
Der Mensch ist ein Mängelwesen. Verglichen mit dem Tiger oder Bären ist er schwach und langsam, verglichen mit dem Hund schwerhörig, verglichen mit dem Adler oder der Eule blind und träge. Im Vergleich mit jedem Fisch ist das, was der Mensch als Schwimmen bezeichnet, ein hilfloses Planschen. Jede Mücke oder Libelle fliegt geschickter. Aus der Sicht des Gepards sind unsere besten Sprinter lahme Schnecken. Bei olympischen Wettkämpfen mit anderen Säugetieren würde der Mensch praktisch in keiner einzigen Disziplin, in der es um Sinneswahrnehmungen und körperliche Leistungsfähigkeit geht, eine Medaille gewinnen. Wenn der Mensch, ob religiös oder nicht, sich in der belebten Welt für etwas Besonderes hält, dann ist das also begründungspflichtig.
Nur der Mensch kann kochen
Nur der Mensch kann kochen! Lange vor der Erfindung der Supermärkte, Gourmetmeilen und Delikatessenläden, als der Mensch sein Essen noch jagte oder sammelte, bereitete er es bereits irgendwie zu. Kein Tier kocht, backt, grillt, brät – nur der Mensch. Er ist das einzige Genusswesen, das nicht nur isst, um zu überleben. Und das bekanntlich oft sehr viel mehr isst, als zum Überleben nötig und der Figur zuträglich wäre.
Damit die Nahrungsaufnahme auch richtig Spaß macht, hat der Mensch seine Fertigkeiten der Zubereitung verfeinert. Unsere vermeintlich nahen Verwandten, etwa Schimpansen und Orang-Utans, brachten es in den vielen Jahrtausenden ihrer Evolution nicht einmal bis zum Kugelgrill. Von französischer Küche, arabischen Desserts und mediterranen Vorspeisen ganz zu schweigen. Der Mensch allein hat eine Kultur der Kulinarik entwickelt. Apropos: Es ist erwiesen, dass manche Tiere dem Alkohol zugeneigt sind, aber noch nie wurde ein Gorilla beim Bierbrauen, ein Braunbär beim Weinkeltern oder eine Giraffe beim Schnapsbrennen ertappt.
Manche Tiere sind ziemlich intelligent
Manche Tiere sind ziemlich intelligent, Delfine etwa oder Affen. Sie verständigen sich über so etwas wie Sprache, können differenziert Laute von sich geben und deren Bedeutung erkennen. Aber kein Tier hat je versucht, seiner Intelligenz oder Sprache Dauerhaftigkeit zu geben. Es gibt in der Tierwelt keine Dokumentation über den Augenblick hinaus – kein Buch, keine Schriftrolle, keine Höhlenmalerei, keine Schallplatte oder Audiodatei, kein Karten- oder Brettspiel. Das ist zunächst ein Mangel an Technik, aber auch an Kultur.
Aber wann spielen Affen endlich Orgel
Trotz der beeindruckenden Geschicklichkeit vieler Tiere ist ihr Gebrauch von Werkzeugen schockierend primitiv. Keinen Schrauben-schlüssel, kein Fahrrad, ja nicht einmal ein Smartphone haben unsere nahen Verwandten hervorgebracht. Affen amüsieren sich damit, mit Ästen oder Steinen auf irgendwas zu hauen und dabei Töne zu entdecken, doch ein Schlagzeug haben sie nie entwickelt. Hunde und Katzen sind recht musikalisch, haben aber keinerlei Musikinstrument hervorgebracht. Von Kompositionen ganz zu schweigen. Wie lange, Herr Darwin, dauert es noch, bis „Menschenaffen“ eine Orgel, eine Mundharmonika oder ein Triangel bauen? Hard Rock auf der E-Gitarre improvisieren und Gregorianische Choräle singen?
Nur der Mensch denkt geschichtlich
Nur der Mensch denkt geschichtlich, gibt also Informationen über mehr als zwei Generationen weiter. Große Dynastien wissen, welcher Urururururgroßvater im Dreißigjährigen Krieg wohin ausgewandert ist, um dort durch historisch nachvollziehbaren Sex der Familie reichlich Nachfahren zu schenken. Tiere kennen im glücklichsten Fall ihre Eltern und ihre Kinder. Trotz ihres legendären Gedächtnisses ist kein Elefanten-Museum bekannt. Manche Leute wissen über Caesars Machtergreifung mehr als über den Arbeitsalltag ihrer Nachbarn, lesen Aristoteles im Original und zitieren Voltaire wie einen Zeitgenossen. Mag sein, dass die Geschichte wenige Schüler hat – aber sie lehrt unaufhörlich. Jedoch nur Menschen.
Das hat damit zu tun, dass wir Menschen durch die Entwicklung von Schriften so etwas wie ein Gedächtnis der Menschheit geschaffen haben. Schon zwölfjährige Gymnasiasten enträtseln Ciceros Reden gegen Catilina, die auch nach knapp zwei Jahrtausenden lehrreicher sind als alle Bundestagsreden. Es ist dem Menschen nicht gegeben, in die Zukunft zu sehen (nicht einmal um die übernächste Straßenecke), aber sehr weit und differenziert in die Vergangenheit: Keiner von uns weiß, ob er am kommenden Sonntag noch lebt, aber über das Leben und Sterben der Ägypter, Kanaaniter und Mesopotamier vor drei Jahrtausenden wissen wir recht gut Bescheid.
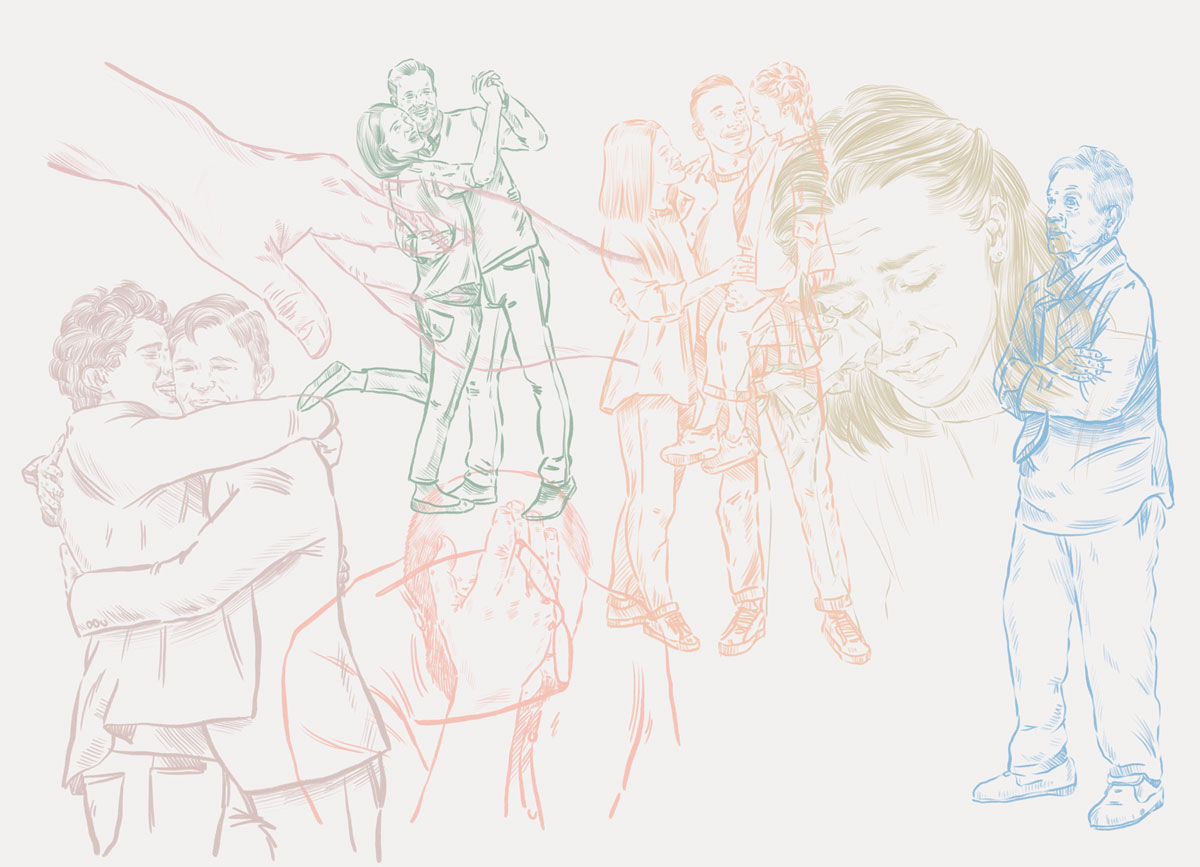
Ehrfurcht vor unseren Ahnen
Wir können unserer Ahnen sogar pietätvoll gedenken. Anders als Tiere, die ihre Urgroßeltern nicht kannten und nichts von ihnen wissen, blicken wir voll Ehrfurcht auf das vergilbte Foto, das den Ururgroßvater am Vorabend des Ersten Weltkriegs zeigt, auf das Hochzeitsfoto unserer Urgroßeltern oder auf Gemälde und Statuen, die mittelalterliche Kaiser und neuzeitliche Dichter zeigen. Wir wissen nicht nur von der tragisch verliebten Fürstentochter, die ihren Ritter nicht heiraten durfte und darum den Rest ihres Lebens in einem bitterkalten Kloster verlebte. Ihre Geschichte wühlt uns sogar emotional auf: Sie macht uns traurig, nachdenklich, wütend, empört. Wir empfinden Empathie mit Menschen, die wir nie persönlich kennenlernten, weil sie Jahrhunderte vor unserer Geburt starben oder tausende Kilometer von uns entfernt leben. Mühelos überbrücken wir zeitliche oder räumliche Distanz, indem wir uns an langen Winterabenden ihre tragischen, schauerlichen oder schönen Geschichten erzählen, für diese Menschen beten oder spenden. Nichts dergleichen haben Biologen in der Tierwelt entdeckt. Da gibt es zwar Empathie und Gefühle, aber nur für die unmittelbare Umgebung.
Die menschliche Fähigkeit zur Empathie
Die menschliche Fähigkeit zur Empathie über die eigene Sippe hinaus hat ermöglicht, so etwas wie „Menschheit“ zu denken. Nur weil wir Menschen, denen wir faktisch nie begegnen, ja nicht einmal begegnen können, auch als Menschen (mit ähnlichen Gefühlen und Rechten) erkennen, rührt uns „Romeo und Julia“ bis heute zu Tränen, leiden wir mit Homers tragischen Helden, empören uns Mord und Verrat im Nibelungenlied. Die literarische und kulturelle Tradition der Menschheit ist nicht denkbar ohne das Mitfühlen mit dem Fernen und Fremden, in dem wir Nahes und Vertrautes wiedererkennen. Warum werden unsere Augen feucht, wenn Winnetou in den Armen seines Blutsbruders stirbt? Warum bangen wir mit dem kleinen Hobbit Frodo oder atmen erleichtert auf, wenn „Die glorreichen Sieben“ endlich gesiegt haben? Weil die von Menschen geschaffenen Fiktionen stets von Menschen irgendwo, irgendwann Erlittenes und Erfahrenes spiegeln: Menschenschicksal.
Gewiss, auch Bienen und Ameisen sind Teamplayer, verfügen über komplexe Sozialstrukturen und kennen Hierarchien. Doch nur der Mensch hat soziale Systeme geschaffen, die über den Radius seiner Bekanntschaften hinausgehen. Wir organisieren unser persönliches Leben nicht bloß innerhalb eines Stammes und eines Dorfs, sondern in riesigen, anonymen Staaten und supranationalen Organisationen. Ob diese halbwegs ordentlich oder grottenschlecht funkti-onieren, hängt – das ist erwiesen – jedenfalls nicht von deren Größe oder von der Vielfalt ihrer Kulturen und Sprachen ab.

Die Sinnfrage ist unausweichlich
Viele Tiere haben ein tragisches Leben, aber der Mensch weiß um die Tragik des Lebens an sich. Wie großartig, toll und sorgenfrei es auch sein mag: Unsere Sehnsüchte, Wünsche und Hoffnungen passen da einfach nicht hinein, in diese 70 oder 90 Lebensjahre. Um diese Begrenztheit wissen wir früh: Der Mensch erlebt nicht nur das Sterben anderer – er lebt sein Leben unter dem Damoklesschwert der eigenen Sterblichkeit. Wir wissen, dass wir auf den Tod zumarschieren, dass jeder Tag genau ein Tag weniger auf dem vor uns liegenden Weg ist.
Darum ist dem Menschen die Sinnfrage unausweichlich. Er will wissen, warum und wozu er auf Erden ist. Das hat damit zu tun, dass er ein Ich-Bewusstsein besitzt, und zugleich weiß, dass sein Ich nicht identisch ist mit dem Ganzen. Ob der Mensch nun religiös ist oder nicht, er ahnt, dass sein eigenes Leben nur dann einen Sinn besitzt, wenn das Ganze sinnvoll ist. Darum ist er lebenslang auf der Suche nach sinnvollen Antworten – oder glaubt, sie gefunden zu haben.
Zugleich stellt nur der Mensch seine Natur radikal in Frage. Kein Elefant käme auf die Idee, sich als Eichhörnchen zu identifizieren oder so zu benehmen. Kein Wal beschließt, dem Vorbild anderer Säugetiere folgend das Meer zu verlassen, um fortan an Land sein Glück zu versuchen. Der Mensch jedoch stellt seine Menschennatur in Frage, erdenkt Systeme, die alle Menschen zu Tieren erklären oder den Menschen überwinden wollen, um einen „Übermenschen“ zu schaffen. Kulturelle und humanitäre Errungenschaften werden nicht nur bestaunt und gefeiert, sondern in Frage gestellt: Sind Roboter vielleicht auch Personen wie wir? Sind wir vielleicht nur Tiere, wie Echsen und Mücken? Ist die Menschheit insgesamt gar von Übel und „eine Hautkrankheit des Erdenballs“, wie Erich Kästner die Klima-Apokalyptiker vorwegnehmend fragte? – Nur Gedankenspiele einer vernunftbegabten Gattung? Nein, die Selbstzweifel des Menschen sind leider existenziell. Nicht nur Individuen begehen Suizid, sondern mitunter auch Zivilisationen. Typisch Mensch!
Gewiss, auch Bienen und Ameisen sind Teamplayer, verfügen über komplexe Sozialstrukturen und kennen Hierarchien. Doch nur der Mensch hat soziale Systeme geschaffen, die über den Radius seiner Bekanntschaften hinausgehen. Wir organisieren unser persönliches Leben nicht bloß innerhalb eines Stammes und eines Dorfs, sondern in riesigen, anonymen Staaten und supranationalen Organisationen. Ob diese halbwegs ordentlich oder grottenschlecht funktionieren, hängt – das ist erwiesen – jedenfalls nicht von deren Größe oder von der Vielfalt ihrer Kulturen und Sprachen ab.
Erfahre mehr!

