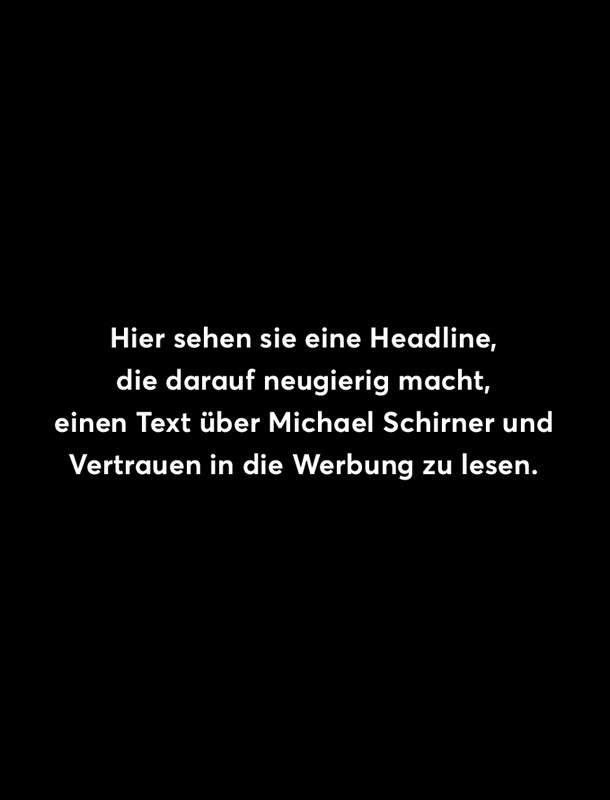
Lesedauer: ca. 7 Min.
Autor: Arno Dietsche
Bilder im Kopf
Die Frage ist nicht, ob wir der Werbung trauen können. Die Frage ist, ob die Werbung uns trauen will, ob sie uns etwas zutraut. Die Werbung? Das sind Leute, die im Auftrag anderer Leute möglichst vielen anderen Leuten etwas verkaufen möchten – und aus diesem Grund wendet sich »die Werbung« auch an mich. Allerdings fühle ich mich fast nie angesprochen. Mir scheint, dass die meisten Werbeanzeigen, Plakate oder Werbespots mich mit jemandem verwechseln. Vermutlich geht es Ihnen, Ihrer Frau, Ihren Freunden oder Nachbarn auch so. Zu wem wird also gesprochen, wenn es zu keinem von uns ist? Es ist die Zielgruppe.
Die Zielgruppe, wer ist das? Das sind immer die anderen. Warum funktioniert Werbung trotzdem, obwohl wir uns alle so gut wie nie angesprochen fühlen? Dass macht die Penetranz. Die Macht der Penetranz wird gerne unterschätzt. Ein neues Produkt, das mit Ausdauer beworben wird, fängt einfach irgendwann an zu existieren. Was es gibt, muss, um mit Darwin zu argumentieren, irgendeinen Überlebenskampf gewonnen haben. Es scheint sich also um ein starkes Produkt zu handeln. Im Regal des Supermarkts greifen wir deshalb nach dem zuvor penetrant beworbenen Produkt, weil wir es zu kennen scheinen, weil es uns vertraut ist. Wir vertrauen dem, was uns vertraut ist.
Wenn wir einem Produkt vertrauen, bedeutet das noch lange nicht, dass wir der Werbung für das Produkt vertrauen, und zwar deshalb, weil sie uns nicht vertraut, weil sie uns unterschätzt. Soziologen nennen die Wechselwirkung zwischen allen, die miteinander kommunizieren, Reziprozität. Penetranz funktioniert leider selbst dann, wenn die Reziprozität nicht in Gang kommt. Penetranz ist nur sehr sehr teuer. Ein Zwanzigmillionen-Etat funktioniert dann vielleicht auch bei langweiligen Werbekampagnen. Die gesellschaftlichen Schäden (Negatives Priming) sind hier nicht berücksichtigt und dürften ein Vielfaches dieses Werbe-Etats ausmachen.
Früher war nicht alles besser. Die Werbung aber schon. Manchmal jedenfalls… Beweise? Bitteschön. Es gibt einen Mann, der den Leuten in Anzeigen, Plakaten und Werbespots immer schon etwas zutraute. Seine Werbung ist ohne unfreundliche Hintergedanken. Hintergedanken sind in der Werbung ein von Marketingspezialisten vorgefertigter Maßgabenkatalog, der das Anfertigen von Bild und Text an einer mehr oder weniger straffen Leine führt. Wer von Hintergedanken gesteuert wird, ist nicht authentisch. Und wer nicht authentisch ist, weiß nicht wirklich, was er tut – was sich in seinen Taten und den Resultaten dieser Taten dann bemerkbar macht. Und das merkt jeder, auch die, die nicht merken, dass sie es merken.
Marketing darf kein Algorithmus für Gestaltung sein. Ein Algorithmus muss bei denselben Voraussetzungen das gleiche Ergebnis liefern. Ein Algorithmus ist also ein Determinismus. Wer sich mit Information beschäftigt hat, weiß, dass Kommunikation so nicht funktioniert. Ohne Überraschung, die das Wahrnehmen und weitere kognitive Prozesse stimuliert, ist im Netz der Synapsen jedes Adressaten Feuerpause. Bevor jetzt, wie es im Marketing gerne gemacht wird, der Text einen auf wissenschaftlich macht, gehen wir lieber auf die Klarheit und das Direkte von Michael Schirners Arbeit zurück. Seine Werbung sagt zu den Leuten: Ich bin nicht blöd. Du bist nicht blöd. Was ich dir zeige und zu lesen gebe, ist erst fertig, wenn du etwas daraus machst. Selbst der Keks, den er im Auftrag von deBeukelaer vorstellte, ging deshalb keinem auf den Keks.
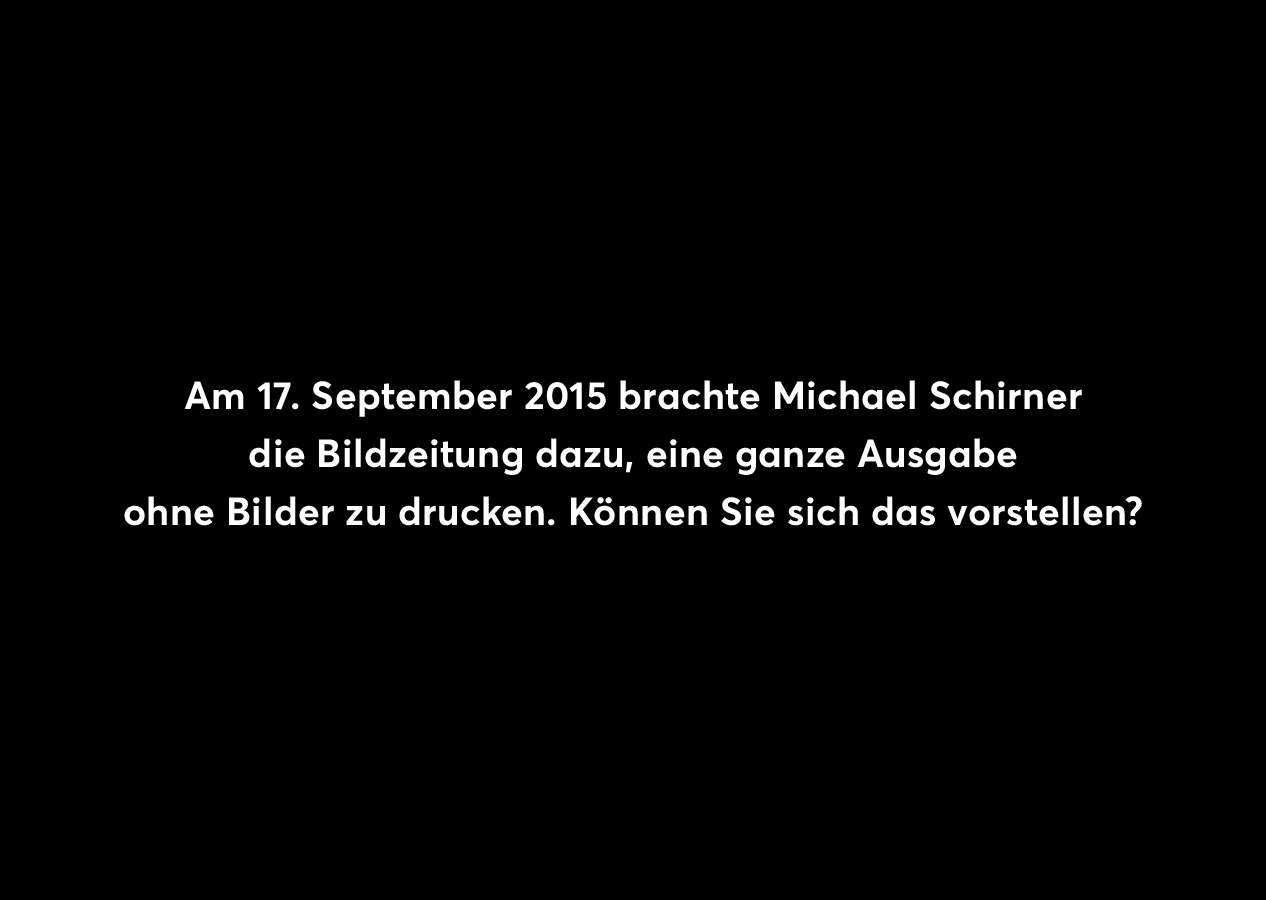
Als ich in den 70er-Jahren im Kino einen kurzen Film im Werbeblock sah, der nur aus einer Abfolge von Buchstaben bestand, die das Wort »schreIBMmaschinen« auf die Leinwand hämmerten, fühlte ich mich sehr geehrt. Jemand hielt mich für intelligent, jemand vertraute mir. Der kurze Werbespot bestand nur aus 16 Buchstaben. In diesen war das Logo der Firma und ein auf kleinstem Raum zusammengefaltetes Initialmaterial untergebracht. Die Aufspaltung dieses Materials in meinem kognitiven System verlief in dieser Abfolge: ich sah, dass IBM intelligente Werbung macht, somit ein intelligentes Unternehmen ist, folglich intelligente Schreibmaschinen herstellt.
Und der Zuschauer versteht: Jetzt braucht es nur noch intelligente Nutzer. Da wäre man ja blöd, würde man sich nicht angesprochen fühlen. Die Tonspur des Films enthielt übrigens nur das akkurate Geräusch des auf Papier treffenden Kugelkopfs der Schreibmaschine. Keine Off-Stimme, die dem Kopf des Zuschauers zugetraut hat, Schauplatz eines Ereignisses zu sein. So ist das mit dem Vertrauen – auch in der Werbung: Wer etwas zu sagen hat, sollte dem anderen so viel Verstand unterstellen, wie er bei sich selbst vermutet. Das ist Reziprozität. Diejenigen, die – im Gegensatz zu mir – in der Schule immer gut aufgepasst haben, dürfen sich hierbei auch an Kants kategorischen Imperativ erinnert fühlen.
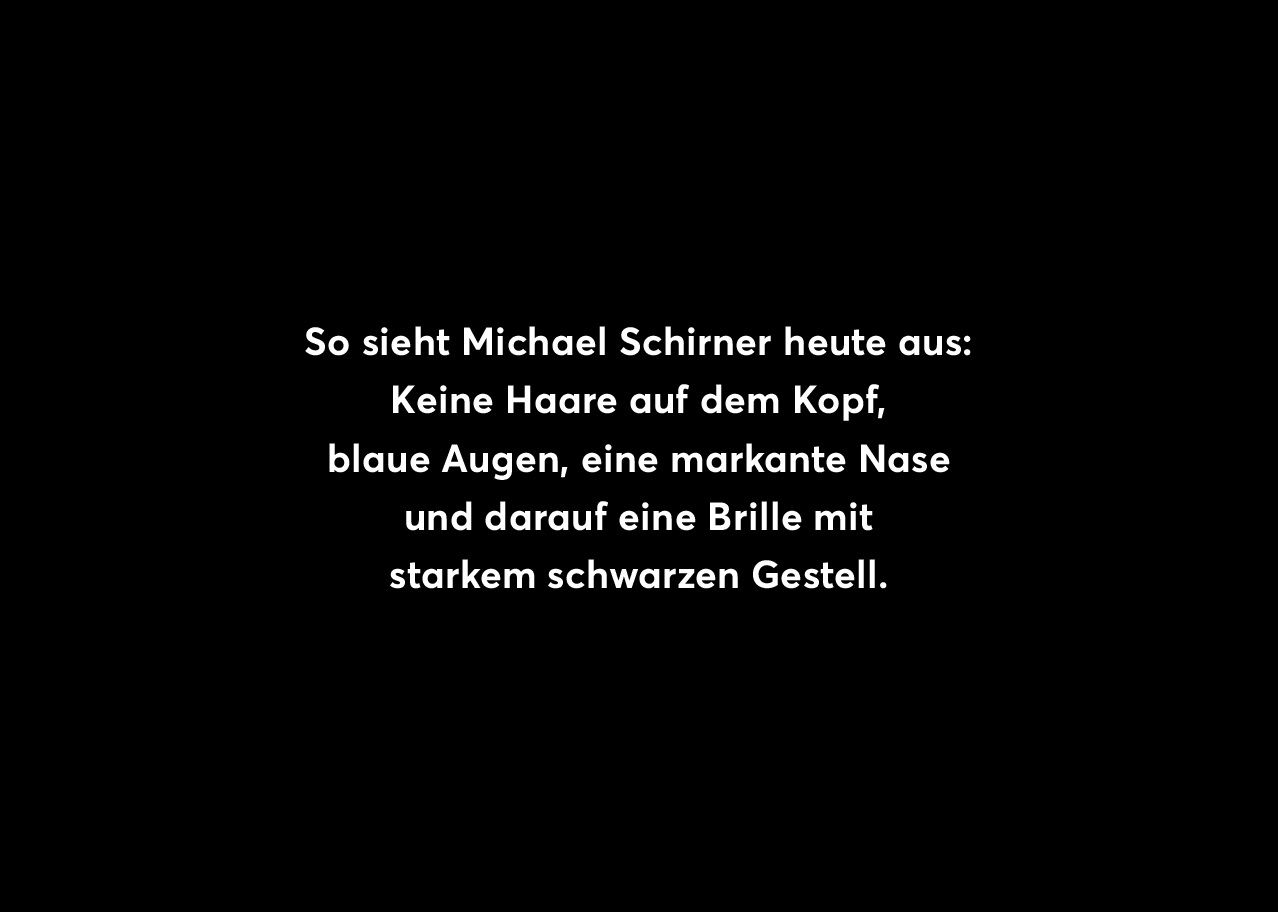
Michael Schirner sagt, dass er Werbung so mache, dass sie im Kopf des Betrachters entstehe. Nur ein guter Autor schafft es, dass die Figuren seines Romans sich im Kopf des Lesers aus Worten und ein paar Satzzeichen in lebendige Charaktere verwandeln. Jeder Künstler braucht ein Publikum, nicht für den Applaus, sondern als Partner für die Vollendung seines Werks. Deshalb ist Werbung Kunst, wenn sie mit dem Betrachter zusammenarbeitet, statt ihn zu bearbeiten, und wenn es dem Betrachter dabei gelingt, ein eigenes und für ihn selbst neues Bild im Kopf entstehen zu lassen. Michael Schirner ist Künstler, er weiß, wie er die Klischees aus dem Weg räumen muss, um den Schauplatz für Ereignisse im Kopf der Leute frei zu bekommen.
Werbung ist für eine Kooperation mit dem Betrachter in gewisser Hinsicht sogar geeigneter als museale Kunst. In einem Museum oder einer Galerie sieht alles, was dort auf dem Boden steht oder an der Wand hängt, wie Kunst aus. Die Umwelt für Werbung ist profan, sie muss ohne die Kunstweihe eines »white cube« auskommen. Das Weihevolle, das im Kunstraum für die Aufwertung der Kunst sorgt, ist der mentalen Beteiligung der Besucher am Gezeigten nicht selten im Weg. Die Kunstwerke präsentieren sich uns bereits so vollgesogen mit restlos definierter Bedeutung und Bewertung durch Theorie, dass sie sich vom Betrachter nur noch nachvollziehen oder feiern lassen wollen. Freiräume für die Wahrnehmung sehen aber anders aus. Unser Gehirn braucht qualitative Stimulanz – im grauen Alltag noch mehr als am Museumssonntag.
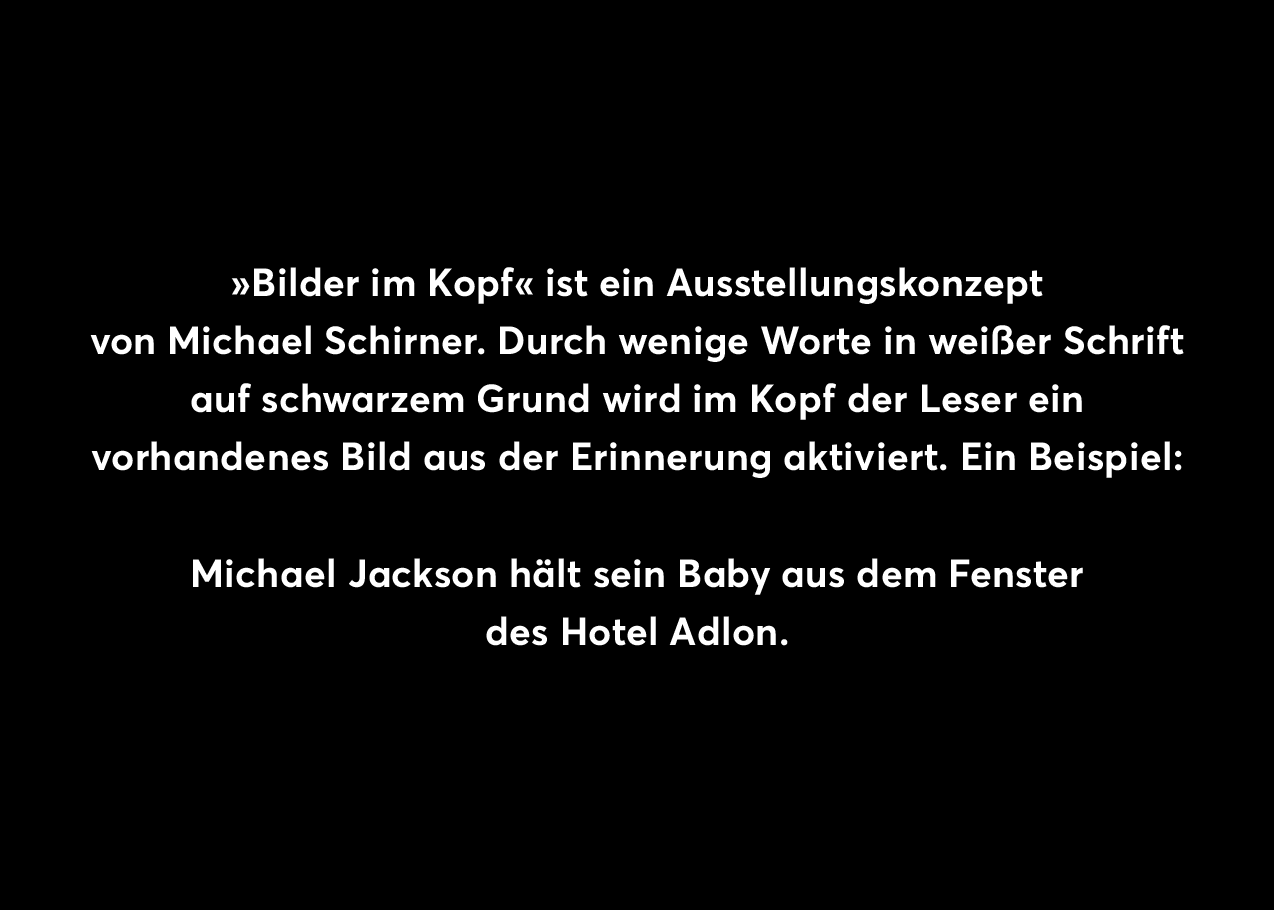
Schirner hat gesehen, dass in der Werbung das Potential für die kluge Interaktion mit der Gesellschaft steckt. Warum das also nicht zum Nutzen aller nutzen und kleine Ereignisse von Kultur (Freude am Denken, Freue am Schauen, Freude am Hören) in Szene setzen? Einem Massenpublikum Intelligenz zuzutrauen und Lust auf Partizipation zu machen, das ist die Praxis von Michael Schirner, die den Unterschied macht.
Hier geht es weiter zu vielen Beispielen aus dieser Praxis: www.michaelschirner.de

