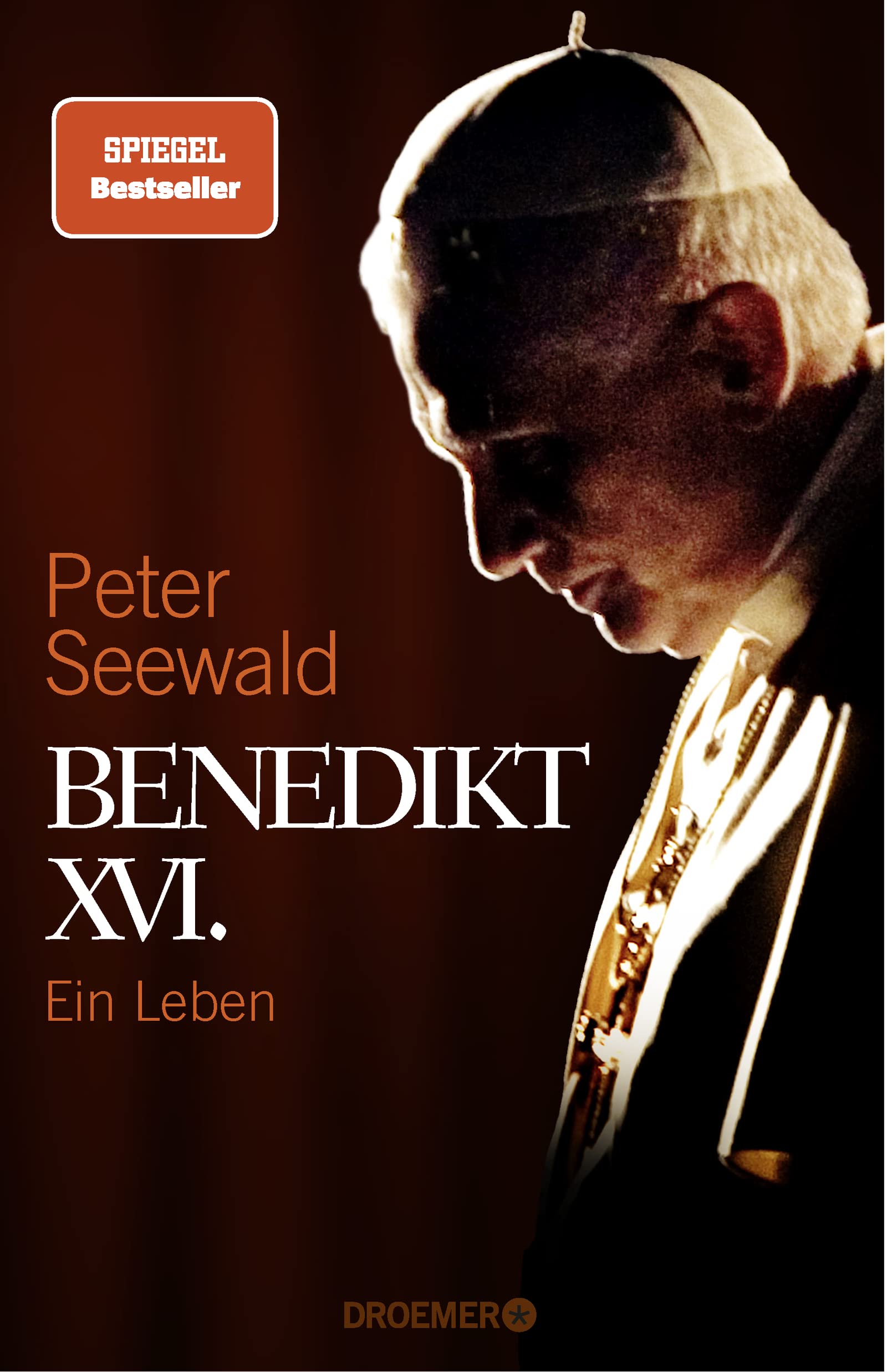Als ich begann, wieder an Gott zu denken
Lesedauer: ca. 8 Min. | + Video zum Beitrag
Autor: Peter Seewald | Fotos: Bernhard Spoettel
Der Bestsellerautor und Journalist Peter Seewald, international bekannt durch seine Bücher mit Benedikt XVI., über seinen persönlichen Lebensweg vom Atheismus und Kommunismus zum katholischen Glauben.
Milliarden von Jahren war nur das Weltall da. Erhaben, groß und finster. War es purer Zufall, der den Menschen entstehen ließ? Diesen „chemischen Abschaum auf einem mittelgroßen Planeten“, wie der Astrophysiker Stephen Hawking befand? Oder doch eine Kraft, die man den Schöpfer nennt, die Allmacht schlechthin?
Als ich vor gut dreißig Jahren begann, wieder an Gott zu denken, waren es Fragen dieser Art, die mich beschäftigten. Wie entstand die Urmaterie? Wie kam der Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren zustande? Aus Geist? Aus Information? Niemand konnte behaupten, der Mensch habe sich selbst erschaffen. Oder wir seien es gewesen, die Sonne, Mond und Sterne ans Firmament stellten. Müsste es dann aber nicht auch, überlegte ich, eine faktengestützte, unbezweifelbare Erklärung über die ganze Geschichte geben? Eine Wahrheit über den Kosmos? Über die Welt? Über den Menschen?
Nirgendwo im Weltraum war bislang sowas wie ein Thron Gottes entdeckt worden. Keine Spur von den Heerscharen von Engeln, die in der Bibel verzeichnet sind. Und doch waren noch alle Versuche, die Entstehung des Lebens ohne Gott zu erklären, gescheitert. „Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch“, fasste der Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg zusammen, „aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott“. Gott würfelt nicht, ergänzte Albert Einstein, „vielmehr hat Er die Welt nach einem ordentlichen Plan geschaffen, den zu finden Aufgabe der Wissenschaftler ist.“
Was können wir wissen?
Was können wir wissen? Müsste jeder, der sich auf die Suche nach der Wahrheit begibt, ganz unweigerlich auf Gott stoßen? Nach dem Diktum, das Jesus in die Welt brachte: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“?
Als kleiner Junge war ich in dem Dorf, in dem ich groß wurde, ein begeisterter Ministrant. Es gab nur eine kleine Fatima-Kapelle an einer Straßenecke, und am Schönsten war es, dem Herrn Kaplan bei der Rorate-Messen begleiten zu dürfen, früh am Morgen, wenn es noch dunkel war. Oder bei Beerdigungen, wen wir, mit Kreuz und Fahne, dem Leichenzug voranzogen. Wir hatten eine ziemlich genaue Vorstellung von Gut und Böse, und niemand kaum auf die Idee, die religiösen Gebräuche hinterfragen zu müssen. All die Bilder, die Schutzengel und zarten Jesus-Gemälde im Nazarener-Stil schufen eine Atmosphäre, in der es nicht schwer war, mit dem Himmel ins Gespräch zu kommen. Der Katholizismus galt nicht als das Mindere oder gar Verstiegene, sondern das Große und Erhabene.
Von einem Tag auf den anderen jedoch war es mit dem Glauben vorbei. Roger Schutz, der Gründer von Taizé, nannte es „eine Zerrüttung der geistlichen Werte“, die sich „um die Siebzigerjahre“ breitgemacht habe. Als junger Kommunist war es jedenfalls ein Ding der Unmöglichkeit, weiterhin die heilige Kommunion zu empfangen. Gott? Ein Phantasiegebilde, den sich die Kirche ausdachte, um ihren Machtkomplex aufzubauen. Kaum dass ich 18 war, stürzte ich die Treppe des Rathauses hinunter, wo ich eine Austrittserklärung unterschrieben hatte, holte ganz tief Luft und warf die Arme hoch: Endlich frei. Frei von dem ganzen Ballast, der wie Blei auf meinen Schultern lag
”Gott ist tot! Es war wie das perfekte Verbrechen. Ein Mord ohne Leiche.
Gott ist tot! Es war wie das perfekte Verbrechen. Ein Mord ohne Leiche. Als Atheisten waren wir der Überzeugung, Religion sei der Klotz am Bein der Zivilisation. Fortschritt bedeute, sich davon zu befreien, um, ganz schwerelos, endlich in höchsten Sphären zu schweben. Zwanzig Jahre später sah vieles anders aus. Macht und Einfluss der katholischen Kirche waren kontinuierlich geschwunden. Die zehn Gebote galten als überholt. Neue Denk- und Verhaltensweisen eroberten die TV-Programme und diktierten den Lifestyle. Es war eingetreten, wovon wir als junge Revolutionäre geträumt hatten. Aber war unsere Gesellschaft so viel freier, gerechter, klüger geworden? War mit dem Verschwinden tradierter Werte, einer aus der griechischen, jüdischen und christlichen Überlieferung stammenden Ethik und dem bislang gültigen Verhaltenskodex nicht gleichzeitig auch der Grundwasserspiegel unserer Kultur Jahr für Jahr weiter abgesunken?
Nach dem Austritt aus der Kirche und dem Abschied von Marx und Mao stand ich irgendwie im Niemandsland. Ein Heimatloser zwischen Politik und Gottesfinsternis. Ich begeisterte mich für Errungenschaften, die es früher nicht gab. Schnurlose Telefonie. Ticketkäufe, ohne einen Fuß vor die Tür setzen zu müssen. Gleichzeitig grübelte ich darüber nach, welche Tabus wir wohl besser nicht gebrochen haben sollten. Schon damals war absehbar, dass sich durch die digitale Revolution und neue Bewusstseinslagen die Konturen zwischen Wirklichkeit und Simulation, zwischen echt und unecht, wahr und unwahr zunehmend verwischen würden. Auch wenn wir uns nicht vorstellen konnten, dass sich schon wenige Jahrzehnt später über Bots, die im Internet Falschnachrichten verbreiten, Börsenkurse und Meinungen manipulieren ließen, dass Algorithmen und entsprechende Apps unsere Gedanken lenken könnten.
In einer Welt, in der das Design das Sein ersetzt, die Lüge die Wahrheit, die Illusion die Fakten, die Fake-News die News, die Animation die Realität, war es schwer geworden, zu unterscheiden. Welche Maßstäbe wären anzulegen, überlegte ich, um im Dschungel der Postmoderne die Orientierung zu behalten? Weihnachten, das Fest der Geburt Christi, war zu einem heidnischen Spektakel geworden. In führenden Buchhandlungen war einsam in einem Regal in der Ecke gerade noch ein Platz von sechs Bleistiftlängen für die geistlichen Grundlagen des Abendlandes reserviert. Im Grunde wusste kam noch jemand, wovon er redete, wenn er über religiöse Dinge sprach. Aber hatte man mit der Entchristlichung der Gesellschaft nicht auch ein im Grunde unverzichtbares Lebenselixier verloren? Vergleichbar mit jenen Erbinformationen, die seit Jahrtausenden in jeder Zelle des Körpers widerhallen?
Ich war weder Christ noch Kirchgänger geworden, aber einen meiner Magazin-Beiträge aus jener Zeit überschrieb ich frech mit „Rettet die Kirche“. Es sei an der Zeit, darüber nachzudenken, was wir verlieren, wenn wir Kirche verlieren. Was hätten wir schon anzubieten? Das „Glücksrad“ von Sat 1 statt der Matthäuspassion? Verzweifelte Theologen statt der Herzensbildung einer Teresa von Ávila? Die Forderung, dass sich die Kirche unisono zur Moderne bekennen und „anschlussfähig“ werden müsse, fand ich abwegig. Zu welcher Moderne eigentlich? Zu einer, die Erich Fromm schon vor Jahren als „krank“ bezeichnet hatte?

Man kann Gott leugnen, aber ganz ohne Glauben geht es nicht.
Es sei die Grundvorstellung von seiner Kirche gewesen, nicht von unserer, ereiferte ich mich wie ein Redner an der Speakers-Corner im Londoner Hyde-Park, ein Mysterium an sich, der Michelangelo und Dürer ihre Talente widmeten. Wohin aber gehe eine Gesellschaft, die sich von ihren Wurzeln trennt? Was bedeutet es für die Zukunft, wenn eine neue atheistische Generation heranwächst, die religiöse Gebote als einen Angriff auf die Menschenwürde versteht? Kirche sei nach eigenem Verständnis kein zufälliges historisches Produkt. Die Frage sei daher eher, wer rettet diese Kirche vor uns? Vor Zynikern und Besserwissern, die nichts mehr zu sagen haben? Vor hochmütigen Skeptikern, die nichts mehr zu glauben wagen? Vor einer Welt, die in Selbstgefälligkeit und Selbstabsolution mehr erstarrt ist, als es die Kirche jemals war?
Man kann Gott leugnen. Man kann sich (wenn es ihn denn gibt) von ihm lossagen. Ganz ohne Glauben aber geht es nicht. Wer Gott links liegen lässt, ersetzt ihn durch die Polit-Religion, die Fitness-Religion, die Ernährungs-Religion, die Öko-Religion, die Ego-Religion, durch Götter wie Geld, Konsum, Sex. Durch pseudoreligiöse Ideologien mit säkularen Heilsversprechen, die bestenfalls in einer Sackgasse endeten, wenn nicht in einer Welt der Lüge, des Hasses, der Gängelung und des Unrechtes. Im Licht des Glaubens besehen, war die Ignoranz gegenüber der Ordnung der Schöpfung die Grundkatastrophe der Menschheit schlechthin. Wenn ich es richtig sah, verwies im Westen jedoch nur noch die römisch-katholische Kirche auf die „unerschütterlichen Wahrheiten“, abzulesen im Naturgesetz, das eigentlich ein moralisches Gesetz sei, eine Urevidenz, da manche Haltungen, weil dem Sein widersprechend, wirklich und immer falsch seien
Vom französischen Mathematiker und Philosophen Blaise Pascal wird erzählt, er habe, als er die Wahrheit des Glaubens kennen lernen wollte, einfach den Rat eines Freundes befolgt. Mach‘ zunächst einmal das, riet er ihm, was die Gläubigen tun, selbst wenn es dir noch unsinnig erscheint. Pascal war der Überzeugung, der Mensch sei gleichzeitig gläubig und ungläubig, zaghaft und wagemutig, ein zutiefst widersprüchliches Wesen. Später bemerkte er, man habe nichts zu verlieren, wenn man sich auf das Christentum einlasse. Wer zum Glauben komme, habe hinzugewonnen, wer das nicht schaffe, habe nichts verloren.
”Nun, ich machte es ein wenig wie Pascal. Es war das Beste, was mir passieren konnte.
Die Morgenmesse, die ich in meinem Viertel besuchte, war nicht eben überfüllt. Neben dem Priester gab es vier oder fünf ältere Frauen, einen greisenhaften Mann – und mich. Ich stellte mich in eine der Kirchenbänke und machte das Kreuzzeichen. Kniebeugen kosteten mich Überwindung. Aber obwohl ich Zweifel hatte und den Botschaften der Offenbarung misstraute, schien mir, als geschähe in diesem Raum etwas, das wie eine Lichtschranke wirkt und wirklich auch Dinge öffnen konnte. Alles war so viel größer als das, was man auf Konzerten, Ausstellungen oder in Fußballarenen erleben konnte. Zum Glück kannte der Priester keine selbstgebastelten Einlagen. Auf eine Predigt verzichtete er zugunsten von Momenten der Stille, die einen auch selbst innerlich still, zu einem Hörenden werden ließen. Geheimnis des Glaubens: Sollte es hinter dem jahrtausendealten Gewebe aus Liturgie, Gebeten und Geboten, überlegt ich, nicht eine Wahrheit geben? Führten diese auf der metaphysischen Ebene letztlich nicht auch in jene andere, zweifellos existierende Dimension, die mit dem Verstand alleine nicht zugänglich ist?
Religionen geben uns einen Ort in der Welt. Sie seien, so der Psychoanalytiker C. G. Jung, „psychotherapeutische Systeme in des Wortes eigentlichster Bedeutung“. Was Pascal betrifft, fand man nach seinem Tod im Futter seiner Weste ein „Mémorial“ eingenäht. „Dies ist das ewige Leben, dass sie Dich erkennen“, notierte der Universalgelehrte, „den einzig wahren Gott, und den Du gesandt hast. Jesus Christus.“ Ich war Lichtjahre davon entfernt, derartige Mémorials zu verfassen. Aber ich war neugierig geworden. Wie hatte es Graham Greene gesagt? Die katholische Religion sei „ein Mysterium, das nicht zerstört werden kann – nicht einmal von der Kirche.“
Da war die Surrealität, die den Katholizismus völlig aus dem Rahmen hob. Die zeitlosen Rituale und Gebräuche. Die Paradoxe, die nicht nur überraschten und schockierten, sondern, weil sie das eigentlich Unfassbare ausdrückten, nachgerade als Beleg dafür galten, dass im christlichen Glauben Wahrheit zum Ausdruck komme. Mit einem Gott, der durch den Tod zum Leben führt. Mit Maria: zugleich Jungfrau und Mutter. Mit Christus: ganz Gott und ganz Mensch. Mit der Kirche selbst: sichtbar verfasste Gemeinschaft und doch auch unsichtbar; heilig und sündig zugleich, fertig und immer auf dem Weg. Verrückt, oder? Im Christentum ist das Kleinste das Größte. Das Einfachste das Schwierigste. Diejenigen die unten sind, sind eigentlich oben, und jene, die oben sind, sollten sich schleunigst bücken, um in der Tiefe wieder die Höhe zu erkennen.
”Für manche Menschen ist der Weg zum Glauben so kurz wie die Zündschnur an einer Silvester-Rakete. Bei mir hatte der Weg offenbar ein Tempolimit
Ich hatte angefangen, nach Lektüre zu suchen. Zunächst bei jüdischen Autoren wie Isaac B. Singer, der in seinen Geschichten aus Lublin und Manhattan so selbstverständlich über Gott schrieb, als ginge es um Zähneputzen. Franz Werfels Roman über Bernadette von Lourdes gab mir eine Vorstellung über die Möglichkeiten des Heiligen. Werfel war fest davon überzeugt, von der „Immaculata“ in höchster Not von den Nazis gerettet worden zu sein. In Gilbert K. Chesterton, dem Autor der Pater-Brown-Krimis, fand ich einen streitbaren Publizisten, der von Papst Pius XI. mit dem Titel Fidei Defensor, Verteidiger des Glaubens, geehrt wurde. Über seine Konversion schrieb er: „Die Klarheit und Entschiedenheit gegenüber den wichtigsten Fragen des Lebens finde ich nur in der katholischen Kirche.“
Nehmen wir Maurice Blondel. „Ja oder nein, hat das Leben einen Sinn?“, begann sein Werk L’Action, das zum Manifest einer katholischen Erneuerung wurde. Blondel wollte den Dingen auf den Grund gehen: „Ich muss es vom Herzen haben. Wenn es etwas zu sehen gibt, dann muss ich es sehen.“ Nach über 400 Seiten messerscharfer Reflexion zog der Philosoph das Fazit: „Es gibt im Menschen ein Leben, das besser ist als der Mensch, und dieses Leben vermag der Mensch nicht aus eigener Kraft zu hegen; es muss etwas Göttliches in ihm wohnen.“
Für manche Menschen ist der Weg zum Glauben so kurz wie die Zündschnur an einer Silvester-Rakete. Der französische Journalist André Frossard zum Beispiel brauchte dazu gerade einmal fünf Minuten. Der Sohn des Mitbegründers der Kommunistischen Partei Frankreichs, aufgewachsen in einem atheistischen Haushalt, betrat am 8. Juli 1935 um 17.10 Uhr die Kapelle der „Schwestern von der Sühnenden Anbetung“ in der Rue d‘Ulm in Paris. Um 17.15 Uhr verließ er sie als „katholischer, apostolischer, römischer Christ, emporgehoben, getragen, erfasst und fortgerissen von einer Woge unausschöpflicher Freude“, wie er festhielt.
Bei mir hatte der Weg offenbar ein Tempolimit. Vielleicht hatte ich auch nur eine lange Leitung. Sagen wir es so: Die Notwendigkeit der Kirche konnte ich sehr schnell schlucken. Was davon abhängt, ob eine Gesellschaft sich an der Hybris des Menschen ausrichtet oder an einer gewissermaßen höheren Ethik, hatte die jüngste Geschichte leidvoll gezeigt. Nicht zu vergessen den sozialen Kitt, den sie der Gesellschaft gab. Mit Gott hingegen rang ich wie Jakob im Fluss Jabbok. Dass Kirche erst durch das Heilswirken Gottes, durch das Mysterium Christi, durch ihren unveränderlichen sakramentalen Charakter zur Kirche wird, hatte ich beiseitegeschoben. Es war die unapostolische, unwirkliche, ungläubige, unwahre Placebo-Kirche in einem potemkinschen Dorf. Das heißt: Man tat nur so als ob. Als ob man Christ sei. Als ob man bete. Als ob man aufrichtig die heilige Eucharistie empfange. Als ob man in der Menschwerdung Gottes wirklich das größte Ereignis der Weltgeschichte sehe. Als ob man an das ewige Leben glaube. Als ob man in und mit Jesus Christus die alles entscheidende persönliche Begegnung habe.

Überraschende Begegnung mit dem „Panzerkardinal“.
Aus der Kirche auszutreten geht relativ einfach. Wieder einzutreten ist im Grunde unmöglich, jedenfalls ohne Beistand „von oben“. „Wir sind nicht irgendwelchen klug ausgedachten Geschichten gefolgt“, heißt es in einem Apostelbrief. Leicht gesagt, wenn man, wie Petrus und Company, „Augenzeugen Seiner Macht und Größe“ war. Wenn Christus wirklich der verheißende Erlöser sein soll, Gott von Gott, Licht von Licht, fragte ich mich, was ist das dann für ein Gott? Ein guter, der uns hilft? Ein zynischer, der gelangweilt Zeile für Zeile in seinem großen Buch des Lebens weiterschreibt und das Böse böse sein lässt? Trägt die Welt ein Ablaufdatum in sich, das immer näher rückt, weil Christus, wie er ankündigte, in den apokalyptischen Wehen des Jüngsten Tages aller Leidenszeit ein Ende setzt – oder geht das auf dieser Erde einfach immer so weiter. So lange, bis wir es ganz geschafft haben, aus dem blauen Planten einen grauen zu machen?
Niemals konnte ich damit rechnen, aber als mir meine Redaktion im November 1992 auftrug, ein Portrait über Joseph Ratzinger zu verfassen, sollte sich bald die Chance ergeben, den Berg von Fragen, der sich vor mir auftürmte, ein wenig abarbeiten zu können. Der Kardinal hatte keine gute Presse. Sein Dauergegner Hans Küng wurde nicht müde, ihn als Großinquisitor zu zeichnen. Die Waggons an Leichen, die er im Keller habe, schrien zum Himmel. Umso überraschter war ich, bei unserer ersten Begegnung auf einen bescheidenen, zugänglichen Mann zu treffen, der so gar nichts von einem Kirchenfürsten an sich hatte, und von einem „Panzerkardinal“ erst recht nicht.
Als ehemaliger Spiegel-Autor stand ich Ratzinger nicht unbedingt nahe. Doch zunehmend beeindruckte mich sein Nonkonformismus. Er sagte aufregende Sätze wie: „Den Sinn des Lebens Christi fassen, heißt eindringen in die göttliche Wirklichkeit“. Oder auch, zum Christentum gehöre „das Hinausgehen aus dem, was alle denken und wollen, aus den herrschenden Maßstäben, um ins Licht der Wahrheit unseres Seins zu finden.“ Der Kardinal galt als einer der klügsten Denker unserer Zeit, einer der letzten Weltdenker, gleichzeitig blieb er ein Unbequemer, der seine Gegner auf die Palme brachte. „Die Kirche hat von Christus her ihr Licht“, beharrte er, „wenn sie dieses Licht nicht auffängt und weitergibt, ist sie nur ein glanzloser Klumpen Erde.“ Geschäftigkeit, Selbstdarstellung und lähmende Debatten um Strukturfragen gingen „am Auftrag der katholischen Kirche völlig vorbei“.
Zur Vorbereitung auf das Treffen im Vatikan hatte ich mich in Ratzingers Schriften eingelesen. Mir imponierte sein substantieller Stil, der nicht auf Slogans und Effekte, sondern auf Inhalte setzte, und nicht zuletzt sein scharfer Intellekt, mit dem er aufzeigte, dass Religion und Wissenschaft, Glaube und Vernunft keine Gegensätze sind. Crede, ut intelligas, glaube, damit du erkennst, sagte er mit dem heiligen Augustinus. Denn verfügbar werde die Wahrheit nur in der Erleuchtung durch den göttlichen Geist. Er selbst habe Gott und den Glauben mit und über die katholische Kirche gefunden. In der Schrift, in den Zeugnissen der Heiligen, in der Liturgie, in den Gebeten, in der Eucharistie. Vor allem auch in den Menschen dieser Kirche, oft ganz einfachen Leuten, die sich den Sinn für das Heilige und die Verehrung Gottes bewahrt hätten.
Zu meiner Verblüffung entdeckte ich, dass sich der Kardinal als Bischofsmotto einen Spruch aus dem Johannesevangelium gewählt hatte: „Mitarbeiter der Wahrheit“, was in seiner Funktion als Präfekt der ehemaligen Heiligen Inquisition als pure Provokation erscheinen musste. Wobei Wahrheit hier nicht im juristischen Sinne gemeint war, sondern in Bezug auf die Offenbarung Jesu. Das Problem des Menschen von heute sei, warnte Ratzinger, „dass er in einer Welt hoffnungsloser Profanität lebt, die ihn bis in die Freizeit hinein unnachsichtig programmiert“. Eine religiöse Sichtweise hingegen lege zugrunde, dass „Wahrheit ein grundlegendes Lebenselement für den Menschen ist“.
In seinen frühen Jahren, bekannte der Kardinal, habe auch er sich gefragt, „ob es nicht eigentlich eine Anmaßung ist, zu sagen, wir könnten Wahrheit erkennen – angesichts all unserer Begrenzungen“. Er habe jedoch erkennen müssen, „dass der Verzicht auf Wahrheit nichts löst, sondern im Gegenteil zur Diktatur der Beliebigkeit führt. Alles, was dann bleiben kann, ist eigentlich nur von uns entschieden und austauschbar“. Was die Kirche betreffe, könne sie niemals darauf verzichten, zu verkünden, dass es im Menschen eine transzendente Würde und in Christus die Wahrheit schlechthin gebe. Über diese Wahrheit lasse sich nicht abstimmen. Sonst wäre sie nicht Wahrheit, sonst wäre Gott nicht Gott. Gewiss, die Kirche habe die Wahrheit nicht gepachtet. Man könne auch nicht sagen, „ich habe die Wahrheit“. Erst umgekehrt werde ein Schuh daraus: „Die Wahrheit hat uns, sie hat uns berührt.“
Geprägt von einer Jugend, als der Wahn, eine Welt ohne Gott und einen „neuen Menschen“ schaffen zu wollen, in Terror und apokalyptischer Verwüstung endete, verließ Ratzinger nie der Mut, sich gegen das „man“ zu stellen. Gegen das, was „man“ zu denken, zu sagen und zu tun habe. Eine Wahrheit auch dann auszusprechen, wenn sie unbequem ist, fühlte er sich genauso verpflichtet wie dem Widerstand gegen alle Versuche, aus der Botschaft Christi eine Religion nach den Bedürfnissen eines von Kirche und Glauben entfremdeten Zeitgeistes zu machen.

Die Vernunft des Menschen und die Sehnsucht nach Wahrheit.
Bange freilich war Ratzinger vor einem völligen Erlöschen der Wahrheit nie. Selbst wenn es scheine, als sei das Verlangen nach Wahrheit erstorben, weil sie als unerreichbar oder nicht mehr erstrebenswert betrachtet wird, trage „die Vernunft des Menschen selbst das Bedürfnis nach dem ‚immer Gültigen und Bleibenden‘ in sich.“ Dieses Bedürfnis stelle „eine unauslöschlich ins menschliche Herz eingeschriebene ständige Einladung dar, sich auf den Weg zu machen, um den zu treffen, den wir nicht suchen würden, wenn er uns nicht bereits entgegengekommen wäre“.
Meine Reise zurück zur Kirche ist nicht zu Ende. „Gott existiert“, schrieb André Frossard über sein Bekehrungserlebnis, „ich bin ihm begegnet“. Es ist wahr, dass einem auf diesem Weg, wie Hildegard Knef in ihrem bezaubernden Chanson sang, rote Rosen regnen und sämtliche Wunder begegnen. Aber da gibt es gleichfalls Müdigkeit, Verzagtheit, dunkle Nächte. Auch das Aushalten einer Welt, die sich sehenden Auges in der Unwahrheit verstrickt, den Schmerz über eine Kirche, die sich in dem Suchen nach sich selbst immer mehr verliert. Freilich, Glaube ist immer gefährdet, in jeder Generation aufs Neue. „Hilf doch, o Herr“, klagt der Psalm Nummer 12, „die Frommen schwinden dahin.“
Ich bin kein besonders guter Christ geworden. Mein Gottesdienstbesuch lässt zu wünschen übrig, und für Gebetszeiten gäbe es noch reichlich Luft nach oben. Ich muss freilich nicht mehr überlegen, ob ich glaube. Ich tu es einfach. Wie sagte Thomas von Aquin: „Für den, der nicht glaubt, ist keine Erklärung möglich. Für den, der glaubt, ist keine Erklärung notwendig.“ Um nicht an aktuellen Skandalen zu verzweifeln, folge ich dem Rat Benedikt XVI., sich nicht mit den gerade in ihr herrschenden Kräften zu identifizieren, sondern mit dem Glauben der Kirche und den Gläubigen aller Jahrhunderte.
„Wollt auch ihr mich verlassen?“, fragte Jesus seine Jünger, als nach der Krise von Kafarnaum die erste große Austrittswelle über die neue Bewegung hereinbrach. Bis heute gilt die zitternde Antwort, die der heilige Petrus gab: „Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens.“